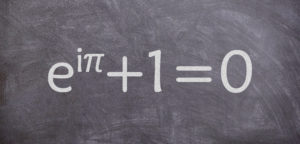© Museum für Gestaltung Zürich / Kunstgewerbesammlung / Zürcher Hochschule der Künste
Am Ornament schieden sich die Geister
Im 19. Jahrhundert entzündete sich eine hitzige Debatte über Ornamente und deren Produktion. Das Thema beherrschte die Kunst- und Kulturwelt und war entscheidend für die Ästhetik der Moderne.
«Über Geschmack lässt sich nicht streiten», besagt eine Redewendung. Das heisst nicht, wie viele Leute denken, dass man jedem seinen Geschmack lassen muss. Die Meinung, dass sich über Geschmack nicht streiten lässt, stammt aus einer feudalen Zeit. Damals war man der Ansicht, dass man entweder Geschmack hat oder eben nicht. Geschmack ist die Summe über eines über Generationen angesammelten Lebensformen. Für Streit also kein Grund. Mit dem Aufkommen der Industrialisierung und der Massenproduktion im 19. Jahrhundert, mit Produktionsmöglichkeiten, wie sie Technik und Wissenschaften erschlossen, änderte sich das. Man begann sich ganz unglaublich über Geschmack zu streiten – und vor allen Dingen damit, ihm dem anderen abzusprechen.
Am deutlichsten wurden diese Meinungsverschiedenheiten in der Diskussion über das Ornament. Es waren paradoxerweise Neorenaissance, Neobarock oder Neogotik, aber auch Orientalimus und Japonismus, die im bürgerlichen Zeitalter der Industrialisierung im Historismus wiederkehrten: ihr gemeinsamer Nenner war das Ornament. Einerseits stritt man sich nun über die Art der Muster, andererseits aber auch über deren Produktion. Der englische Kunsthistoriker John Ruskin (1819 – 1900) etwa prangerte die vollkommene Verdinglichung in der mechanischen Massenproduktion an. Für ihn waren die industriell gefertigten Ornamente wegen ihrer maschinellen Perfektion kalt und steril. Ruskin prägte die Arts and Crafts Bewegung, für die gekonntes Handanlegen, die Handwerkskunst, massgeblich war. Im Zuge der orientalischen Renaissance kam es ausserdem nicht nur zu einer Wiederentdeckung orientalischen Handwerks in Sachen Edelsteine, Stoffe und Keramik, sondern mit dem Triumph der Arabeske zu dem, was viele als leere, schnörkelige Überfremdung der eigenen, klaren Linie und überhaupt als Verstoss gegen jede Gradlinigkeit empfanden.

William Morris (1834–1896) unter Mitwirkung von Philip Webb (1831–1915, Henry Dearle (1860–1932), Ausführung Merton Abbey, London, durch William Knight, John Martin und William Sleath, The Forest, 1887. Wolle und Seide gewebt auf Baumwollkette.
© Victoria and Albert Museum, London
Am Ende dieses Streites um den Geschmack steht Adolf Loos (1870 – 1933) provokative Losung vom Ornament als Verbrechen: «Evolution der Kultur ist gleichbedeutend mit dem Entfernen des Ornamentes aus dem Gebrauchsgegenstand.» Die Avantgarden des Bauhauses hoffen, allen Historismus hinter sich zu lassen und schnörkellos endlich modern und republikanisch männlich zu werden, alles weibische orientalisch idolatrisch Verdinglichte zu überwinden. Es geht um das Entwickeln einer dem Industriellen angemessenen Produktionsform, die mehr und ästhetisch Interessanteres leistet als alte Handarbeit. Die neue, moderne Ästhetik wird proklamiert, in der die Form sich schnörkellos darauf zu beschränken hat, der Funktion zu folgen. Der Üppigkeit eines ornamentalen Erblühens wurde das minimalistische: «weniger ist mehr» entgegengehalten.
Die Lust am Ornament war nun aber irgendwie nicht ganz auszutreiben. Sie ist in vielfältigen Formen und nicht nur in einer neobarocken Opulenz wiedergekommen, die man noch auf das Distinktionsbedürfnis noch nicht so gut erzogener neuen Geldeliten zurückführen könnte. Bei der Wiederkehr des Ornamentalen ist oft, in einer dialektischen List, die Funktion selbst zum Ornament geworden. Oft kommt das Ornament sich selbstironisch affirmierend wieder, als Trash etwa. Oder als Logomanie – Ornamentalisierung mit verschlungenen Buchstaben des Hauses – die das, was das Markenzeichen garantieren sollte, das, was da garantiert werden soll, aber ironisch zersetzten: schlechter Geschmack ist guter Geschmack.
Letzen Ende stehen wir aber langfristig vor einer Renaissance des «Lieblingsstückes». Und Lieblingsstücke sind, das scheint in der Natur der Sache zu liegen, geschmückt, sind Schmuck, kurz, dem Ornament kann man nicht Herr werden. Unsere Inneneinrichtung, unsere Kleider, unser Essen – industriell unter den hässlichsten Bedingungen für Mensch und Natur produziert – wollen wir vielleicht doch nicht ständig entsorgen, jede Saison wegwerfen. Stattdessen slow fashion, slow food and slow design. Eben dies setzt ein savoir faire zwischen Handwerk und Technik voraus, wie es, was die Textilien angeht, etwa in der Ostschweiz nie ganz ausgestorben ist. Die Blumen, die Spitzen, die dort ornamental erblühen, müssen ja nicht eine Ästhetik des Guten, Wahren und Schönen befördern, wie das für die Arts and Crafts die Absicht war, sondern dürfen auch mal als schwüle Blumen des Bösen zieren.

Dekorstoff im Stil des 18. Jahrhunderts, Seidenfabrikant Maison Lamy et Gautier, Lyon, um 1900–1905. Seide gemustert, Lampas-Gewebe.
Musée des Tissus, © Lyon, MTMAD – Pierre Verrier, Inv.-Nr. MT 27696.2