
Sport und Kolonialismus
Was hat eine Ananas mit dem Tennissport zu tun? Genug, um auf der weltberühmten Tennistrophäe des Herreneinzels der Wimbledon Championships zu sein. Die Trophäe wird seit 1887 von Sieger zu Sieger weitergegeben und an der Spitze ziert sie eine kleine Ananas. Dies hängt mit der kolonialen Geschichte des Sports zusammen.

Die «All Blacks» tanzen den Haka am Finale der Rugby-Weltmeisterschaft 2011 in Neuseeland. Youtube
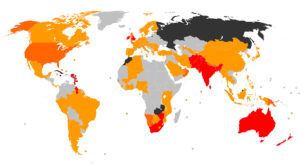


Swiss Sports History

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Swiss Sports History, dem Portal zur Schweizer Sportgeschichte, entstanden. Die Plattform bietet schulische Vermittlung sowie Informationen für Medien, Forschende und die breite Öffentlichkeit. Weitere Informationen finden Sie unter sportshistory.ch.


