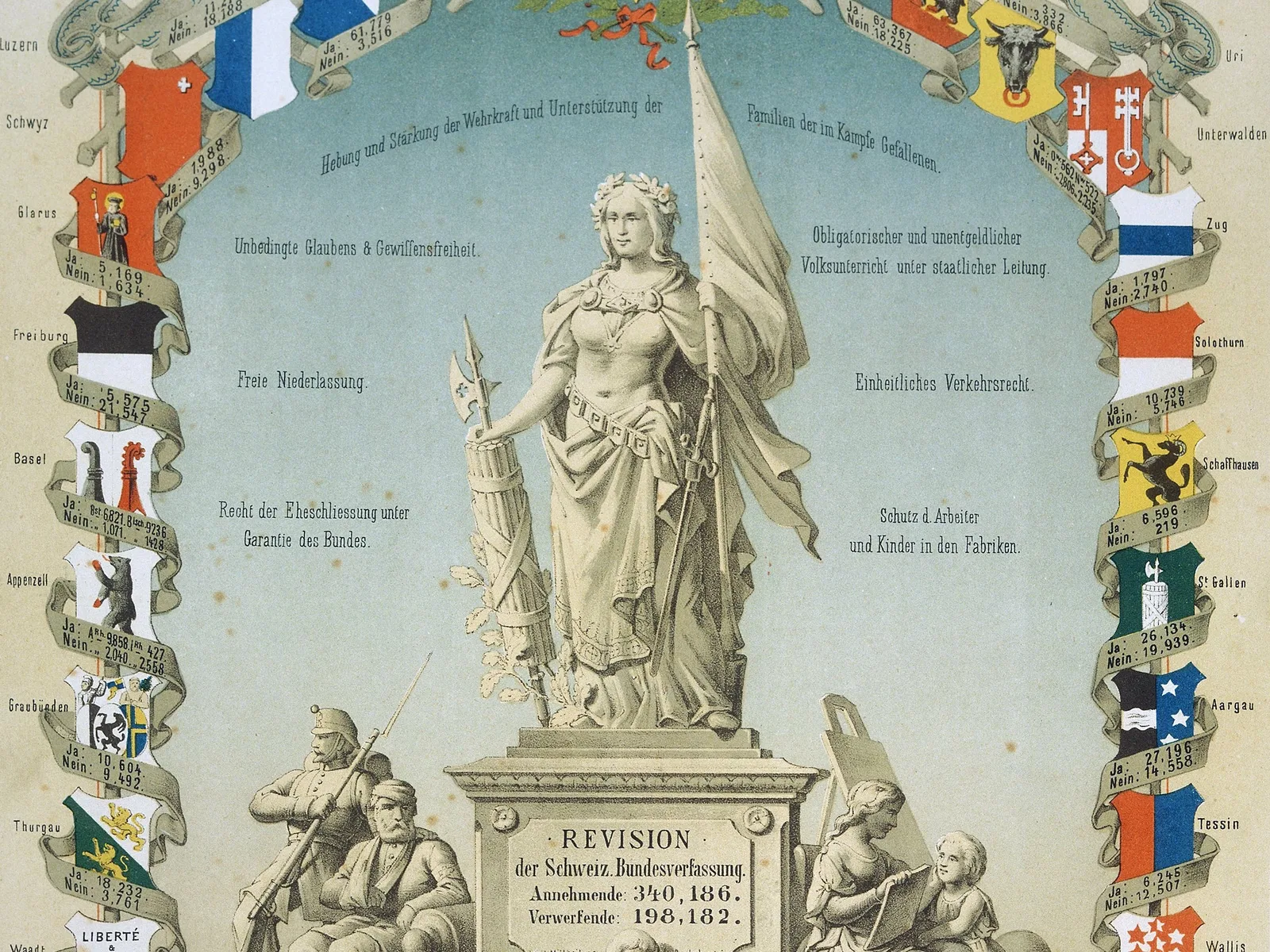Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich
Droben auf dem Freigut!
Anfang des 20. Jahrhunderts war Zürich ein Anziehungsort für jüdische Familien. Ihre Kultur hielt Einzug in der Stadt und es entstanden auch Synagogen. Beispielsweise an der Freigutstrasse.
«An den hohen jüdischen Feiertagen fand sich die ganze Familie in der Freigutstrasse-Synagoge ein. Da der Gebetssaal stets überfüllt war, musste ich mich als jüngstes Familienmitglied stets nach einem freien Platz umsehen. Ausserhalb der Synagoge unweit vom Bahnhof Selnau traf man sich in den Pausen zwischen den Gebeten auf dem Vorplatz, natürlich streng nach Geschlechtern getrennt», erinnert sich Roger Reiss in seinem kleinen Erinnerungsbuch Szenen aus dem Zürcher Stetl an seine ersten Begegnungen mit dem frommen Gotteshaus der Israelitischen Religionsgesellschaft im Zürcher Enge-Quartier.
In keiner Schweizer Stadt gab es um 1900 ein so vielfältiges jüdisches Leben wie in Zürich. In den Jahren nach der rechtlichen Emanzipation von 1866 wird die Stadt zu einem Anziehungsort für jüdische Familien aus dem In- und Ausland. Die erste Welle stammte aus Süddeutschland, dem Elsass sowie aus den «Judenorten» Endingen und Legnau im Surbtal. Und schon ein paar Jahre darauf kursiert in der jüdischen Welt Osteuropas der Ruf, dass in Zürich die «Parnosse» (jiddisch: Geld, Einkommen) auf der Strasse liegt. In der «Statistik der Judenwanderungen» der Stadt Zürich sind für den Zeitraum 1911 bis 1917 insgesamt 7997 zugewanderte Ostjuden vermerkt. Sie kamen aus Russland, russisch Polen und aus Galizien. Meist waren es Nachzüge von schon in Zürich ansässigen Verwandten, so wie es Kurt Guggenheim in seinem grossen Zürich-Roman «Alles in Allem» schildert: «Leib», sagte der Mann im schwarzen Hut, «wir sind da». «Alle?» − «Die Sidia und die Kinder sind unten.» «Mamme», schrie der Hemdsärmelige, «Mamme, der Ruben ist gekommen und die ganze Familie.»

Anfangs des 20. Jahrhunderts war Zürich bei den Juden sehr beliebt. Die Einwanderung stieg an und in der Schweizer Stadt blühte das jüdische Leben auf.
Schweizerisches Nationalmuseum
Charakteristisch für die schnell anwachsende jüdische Gemeinschaft ist, dass die Zugewanderten auch weiterhin den, von den Vorvätern übernommenen Ritus ausüben, der sich in Vielem von der eingesessenen, süddeutsch geprägten Israelitischen Cultusgemeinde (ICZ) unterscheidet. So gründen die aus Osteuropa zugewanderten Juden um 1900 «ihre» Israelitische Religionsgesellschaft (IRG) und schaffen sich in der Folge eigne Einrichtungen. Doch es fehlt viele Jahre lang ein Gotteshaus, das den Bedürfnissen der stark anwachsenden Gemeinde entsprechen würde. 1917 kann sich die IRG einen Anteil am Umschwung des Landolt’schen Gutes auf einer kleinen Anhöhe in der Selnau sichern. 1918 wird ein Architektur-Wettbewerb ausgeschrieben, doch die Finanzierung des Baus ist erst im Frühjahr 1923 sichergestellt.

Grundsteinlegung der Synagoge an der Freigutstrasse in Zürich, 1923.
Israelitische Religionsgesellschaft Zürich
Die Baubewilligung nach den Entwürfen der Zürcher Architekten Henauer & Witschi, bleibt nicht ohne antisemitisch gefärbte Einsprachen. Diese machen geltend, dass die «orientalisch geprägte Architektur» im näheren Umfeld keine Entsprechung habe und zudem den Zuzug «höchst unerwünscht eingewanderter Fremdlinge» nach sich ziehen werde. «Es rechtfertigt sich also nicht […] für diesen Ausnahmefall eines unnützen Gebäudes eine Ausnahme zu machen. […] Wenn denn einmal später das ganze Selnau von den Israeliten aufgekauft ist, dann mögen sie ihnen den Bau der Synagoge gestatten.» Auch der Baupolizeiinspektor macht aus seiner ablehnenden Haltung keinen Hehl. Doch der Zürcher Stadtrat lässt sich davon nicht beirren. Er stellt sich hinter seine Sachverständigen, die zur ästhetischen Begutachtung des Baukörpers feststellen, dass die Ausführung des Gebäudes keine Verunstaltung oder erhebliche Beeinträchtigung des Strassen- oder Stadtbildes oder der landschaftlichen Umgebung bedeute.

Innenansicht der Synagoge an der Freigutstrasse in Zürich.
Archiv für Zeitgeschichte / Michael Richter
Am 14. September 1923 findet die feierliche Grundsteinlegung statt und ein Jahr später, am 17. September 1924 wird die Synagoge an der Freigutstrasse 37 festlich eingeweiht. Die schweizerische Bauzeitung widmet dem aussergewöhnlichen Bau in ihrem Heft 1/1925 eine ausführliche Würdigung: «Wie dem Kirchenbau überhaupt, so fehlt auch dem Synagogenbau eine lebendige, das heisst zwangläufige Tradition. […..] Nehmen wir diese Einstellung also als Tatsache hin, so ist zu sagen, dass die Aufgabe im vorliegenden Fall eine erfreuliche Lösung gefunden hat und dass es sehr viele reformierte und katholische Gemeinden gibt, die diese israelitische Gemeinde um ihre Kultstätte beneiden dürften.»