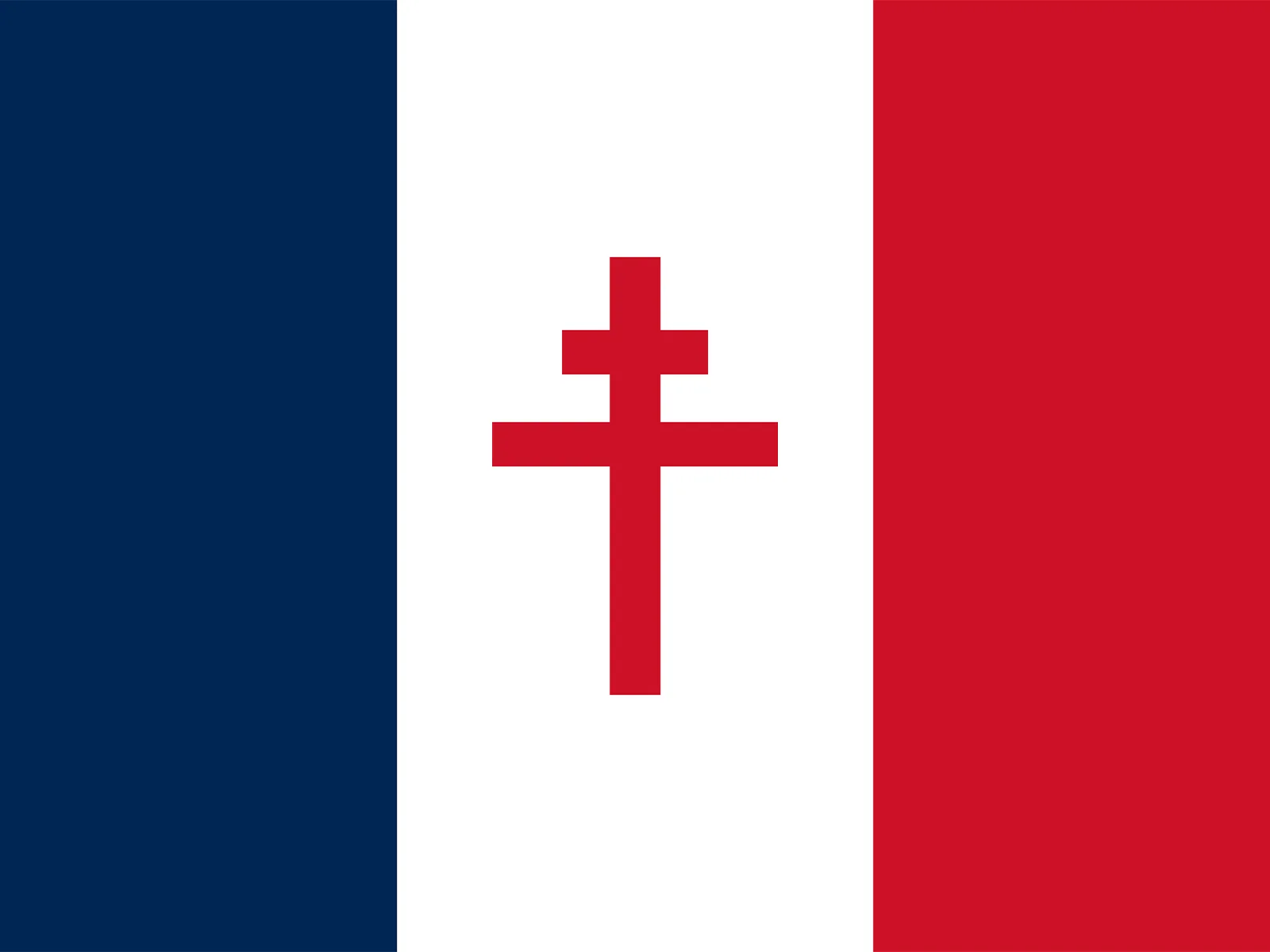Der lange Weg des Dalai Lama nach Bern
Die Schweiz beherbergt seit 60 Jahren die grösste tibetische Gemeinschaft in Europa. Dennoch dauerte es bis 1991, bis der Dalai Lama erstmals durch den Bundesrat empfangen wurde.

Der in demselben Jahr gegründete Verein für tibetische Heimstätten in der Schweiz (VTH), an dem sich auch das Schweizerische Rote Kreuz beteiligte, erhielt 1961 die Bewilligung zur Aufnahme einer ersten Gruppe von 23 tibetischen Flüchtlingen aus Nepal in eine Kollektivunterkunft in der Ostschweiz. Gleichzeitig begann der Oltner Industrielle Charles Aeschimann mit der (heute höchst umstrittenen) Vermittlung von 160 Kindern aus Tibet an Pflegefamilien in der Schweiz. Im März 1963 entsprach der Bundesrat schliesslich dem Begehren des VTH um «Aufnahme von 1000 tibetanischen Flüchtlingen in unserem Land». Die Schweiz beherbergte fortan die grösste tibetische Gemeinschaft in Europa.
Daneben engagierte sich die Schweiz vor Ort für die tibetischen Flüchtlinge in Nepal. Das Königreich an der Grenze zu China war ein Schwerpunktland der noch jungen schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit. Das Programm umfasste diverse Landwirtschafsprojekte sowie verschiedene Massnahmen zur Berufsbildung und zur Förderung der traditionellen Teppichweberei unter den exilierten Tibeterinnen und Tibetern. Die Schweiz war deshalb für die tibetische Exilregierung im indischen Dharamsala von grosser Bedeutung. So ersuchte der Dalai Lama um die Erlaubnis, dass sein persönlicher Repräsentant für Europa sich in Genf ein Büro einrichten dürfe. Der Bundesrat gewährte dies 1964 unter der Auflage, dass sich die Tätigkeit des Vertreters auf religiöse und kulturelle Aspekte beschränke. Die chinesischen Proteste konterte das EDA mit Berufung auf die humanitäre Tradition der Schweiz und mit Verweis auf die neutralitätskonforme Einhaltung der Auflagen durch den Repräsentanten des Dalai Lama.

Generalsekretär Pierre Micheli erklärte strikt, die Schweiz habe als wenngleich kleines Land «in 800 Jahren Geschichte nie akzeptiert, sich dem Willen fremder Staaten zu unterwerfen». Der Bundesrat beschied in einer offiziellen Verlautbarung, man habe sich gegenüber Beijing ausreichend erklärt und werde auf «weitere chinesische Demarchen in der Angelegenheit der tibetanischen Flüchtlinge in der Schweiz nicht mehr eingehen». Verteidigungsminister Nello Celio, der für den abwesenden EDA-Vorsteher das geharnischte Communiqué durch den Bundesrat brachte, bemerkte lapidar, selbst ein Abbruch der Beziehungen zu China wäre «nicht so schlimm»: «Unsere Ausfuhr nach China beträgt lediglich etwa 30 Millionen.» Selten stellte die Schweizer Regierung sich derart spontan und resolut für ihre Werte und Flüchtlinge auf die Hinterbeine.

In der Folge besuchte der Dalai Lama regelmässig die Schweiz. Als er sich im August 1983 in einem Artikel in der «Tribune de Lausanne» über das Verhältnis zu Beijing aussprach und die chinesische Botschaft wegen diesen Äusserungen vorstellig wurde, legte das EDA dem Dalai Lama nahe, «für den Rest seines Aufenthaltes in der Schweiz grössere Zurückhaltung» zu üben. Immer wieder regte der Dalai Lama auch an, von einem Mitglied des Bundesrats empfangen zu werden. Ihre Weigerung begründete die Landesregierung damit, dass die Schweiz sich zwar für kulturelle und religiöse Freiheitsrechte der tibetischen Minderheit ausspreche, Tibet allerdings in Übereinstimmung mit der internationalen Gemeinschaft als integralen Bestandteil der Volksrepublik China betrachte. Der Bundesrat wollte vermeiden, durch einen Empfang den Anschein zu erwecken, man betrachte den Dalai Lama auch als politischen Führer der Tibeter.

Als im Folgejahr der Dalai Lama abermals in die Schweiz reiste, gewichtete das Departement die Kriterien, die für einen Empfang durch den Bundesrat sprachen, anders: «Der Dalai Lama, der sich hinsichtlich der Tibet-Frage durch eine gemässigte Haltung auszeichnet, verdient mit seinen Forderungen nach Beachtung der Menschenrechte (inklusive Minoritätenschutz) eine offizielle Solidarisierung durch die schweizerischen Behörden», hiess es in einer Notiz des EDA. Gleichzeitig wurde unterstrichen, dass dieser Kontakt «keine Änderung in der schweizerischen Beurteilung des völkerrechtlichen Status des Tibet bedeutet». Gewiss verurteilte der chinesische Botschafter in Bern den Empfang bei Bundesrat Felber als «Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas». Die Kritik des Diplomaten fiel jedoch «bemerkenswert milde» aus und er betonte gegenüber dem EDA, «dass es wegen dieses Problems nicht zu einer Polemik kommen sollte».
Die Aktion war geglückt. Der Dalai Lama konnte getrost lächeln.
Gemeinsame Forschung

Der vorliegende Text ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Nationalmuseum und der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis). Das SNM recherchiert im Archiv der Agentur Actualités Suisses de Lausanne (ASL) Bilder zur schweizerischen Aussenpolitik und Dodis kontextualisiert diese Fotografien anhand des amtlichen Quellenmaterials. Die Akten zum Jahr 1991 wurden im Januar 2022 auf der Internetdatenbank Dodis publiziert. Die im Text zitierten Dokumente sind online verfügbar: dodis.ch/C2311.