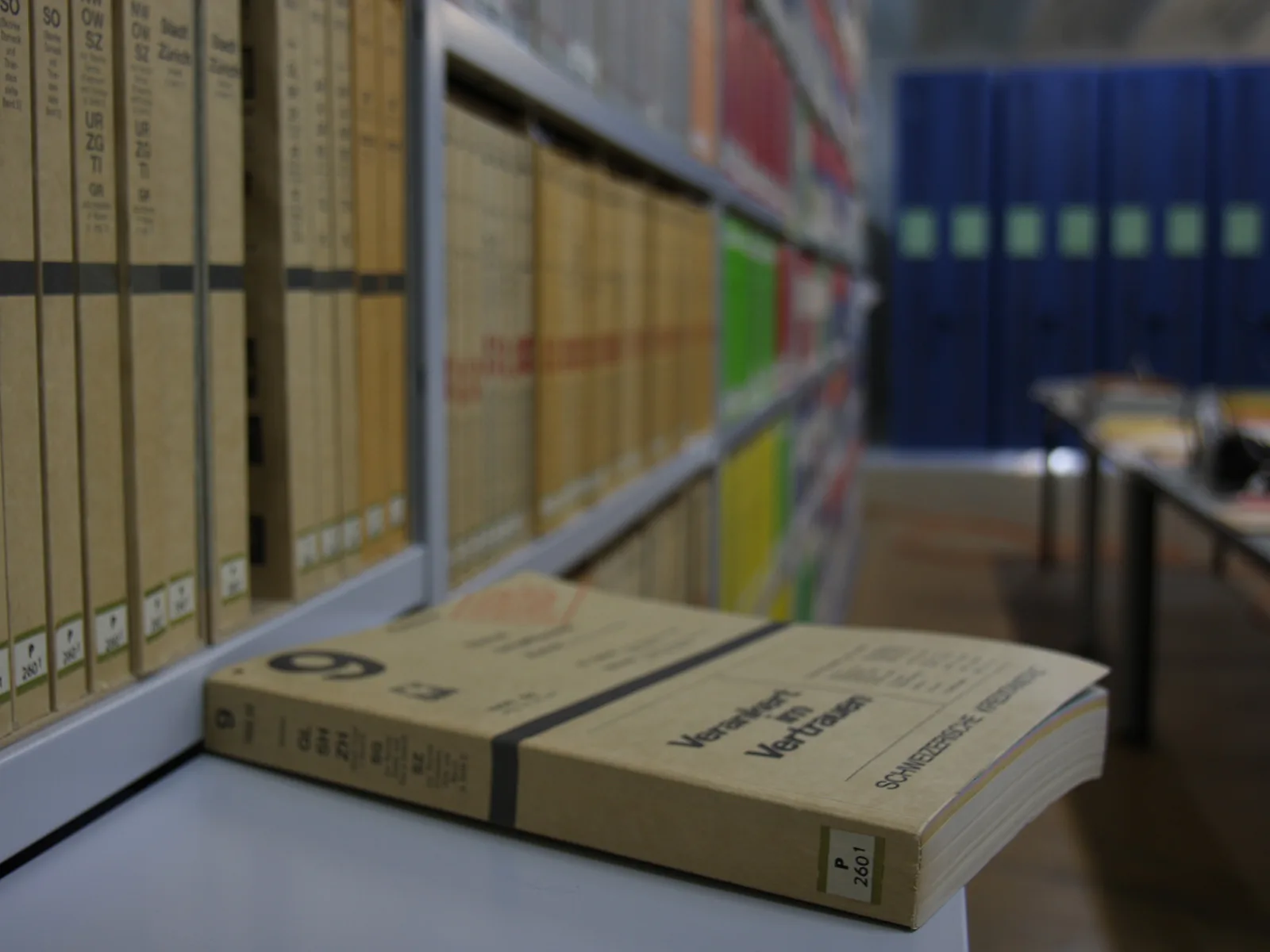Kohle und Uran für das Vaterland
Die rohstoffarme Schweiz war während des Zweiten Weltkriegs verzweifelt auf der Suche nach einheimischen Rohstoffen. Auch im Bernbiet wurde gebohrt, gegraben und untersucht.
Es fehlte es an vielen Gütern und ganz besonders an Rohstoffen, da die Schweiz nicht reich an Bodenschätzen ist. Welche Auswirkungen dieser Mangel an Alltagsgegenständen hatte, zeigt exemplarisch eine Meldung aus dem Oberländer Tagblatt vom 3. Februar 1944, die davon berichtet, dass aufgrund Pneumangels der tägliche Postauto-Mittagskurs von Steffisburg ins Dorf Heimenschwand nur noch montags, mittwochs und samstags durchgeführt werden konnte. Der Nachmittagskurs wurde sogar vollumfänglich eingestellt.

Tatsächlich fand Rutsch bei seiner Begehung eine kohleführende Schicht (Pechglanzkohle) in einer der hohen Nagelfluhwände am Ufer der Rotache. Die Fundstelle war nur schwer erreichbar, trotzdem wurde ein Stollen von rund acht Metern Länge in das Gestein getrieben, um zu ermitteln, wie sich die Kohleschicht im inneren der Nagelfluh entwickelte. Das Resultat war enttäuschend, das Vorkommen erwies sich als zu gering, um lohnend abgebaut werden zu können. Der Bericht von Rolf Rutsch an das «Bureau» fiel entsprechend negativ aus.

So erinnerte sich 1949 der Geologe Dr. Hermann Vogel aus Basel an Kohlestücke, die von ihm drei Jahre zuvor für eine Bergbaufirma untersucht wurden und eine erhöhte Radioaktivität aufwiesen. Sie stammten aus einem Bächlein auf dem Buchholterberg mit dem Namen «Ibachgrabe». Dieser Graben ist einer von mehreren Zuflüssen der Rotache, die nach ihrer 18 Kilometer langen Reise schlussendlich in die Aare mündet. Somit machte Dr. Vogel sich auf, weitere uranhaltige Kohlevorkommen und Mergelschichten in der Region am Buchholterberg zu suchen und vertieft zu analysieren. Er wurde dabei an verschiedenen Orten fündig. Bei der Kohle stellte sich heraus, dass diese in einer dünnen, nicht zusammenhängenden, Schicht von der auf rund 1080 m ü. M. gelegenen Falkenfluh quer über den Buchholterberg bis zur Rotache reicht. In verschiedenen Geländeeinschnitten treten dabei kleinere Kohlenester aus der Nagelfluh hervor. Die Untersuchungen von Dr. Vogel ergaben dann, dass durchaus Radioaktivität im Gestein und der Kohle gemessen werden konnte. Er berechnete, dass aus einer Tonne Ibachgrabe-Kohle wohl rund 1,6 kg Uran gewonnen werden könnte. Doch auch hier erwies sich die geringe Menge an Kohle, verstreut über eine weite, unzugängliche Fläche, als zu grosses Hindernis um einen Abbau vorzunehmen.