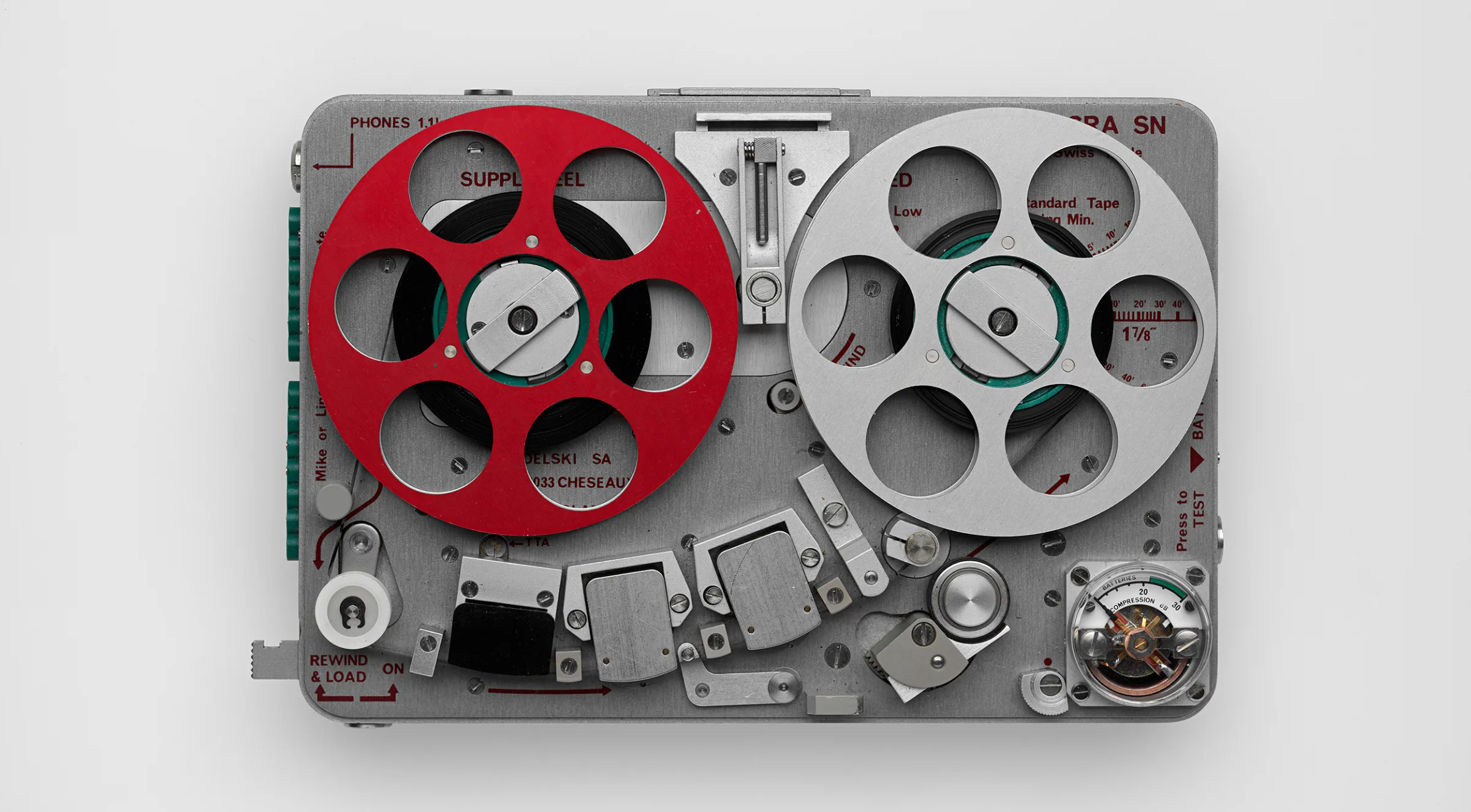1. August in Helsinki
Ausgerechnet am Schweizer Nationalfeiertag 1975 unterzeichnete Bundespräsident Pierre Graber in der finnischen Hauptstadt Helsinki die sogenannte Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Es war ein Zeichen der Entspannung mitten im Kalten Krieg.

Dies sei wohl der beste 1. August seit langem, titelte die Tribune de Genève mit Blick auf die feierliche Unterzeichnung der Charta, welche die Zeitung als Signal des Bundesrats für grössere Offenheit der Schweiz gegenüber der Welt und mehr Engagement in der Aussenpolitik deutete. Tatsächlich handelt es sich bei der Schlussakte von Helsinki um ein aussergewöhnliches Dokument. Es war keine Selbstverständlichkeit, dass, mitten im Kalten Krieg, die Vertreter aller europäischen Staaten aus West und Ost inklusive der Sowjetunion sowie die USA und Kanada an einem Tisch zusammenkamen, gemeinsame Werte beschworen und sich zur Einhaltung gleicher Regeln verpflichteten.
Moskau verfolge mit seinem Vorschlag primär propagandistische Absichten, vermutete auch eine vom Bundesrat eingesetzt Arbeitsgruppe des Aussendepartements. Es ginge den Russen darum, als Friedensstifter aufzutreten, den Status quo in Osteuropa zu festigen, Zwietracht unter ihren Gegnern zu säen und einer zu grossen wirtschaftlichen Konzentration im Westen entgegenzuwirken. «Starkes Misstrauen ist deshalb berechtigt,» mahnten die Diplomaten. Die folgenden Monate zeigten, dass trotz aller Skepsis ein prinzipielles Interesse an der Einberufung einer Konferenz überwog. Sowohl im Westen wie im Osten erhofften sich die Regierungen von der Erörterung multilateraler Sicherheitsfragen eine Verbesserung der Lage auf dem Kontinent. Dabei vertraten die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft, der Nato sowie die neutralen und bündnisfreien Staaten teils divergierende Ansprüche, und selbst der Ostblock erschien weniger monolithisch als gedacht.

Nach den ersten Absichtsbekundungen in den Hauptstädten zwischen Biskaya, Barentsee und Bosporus folgten zwei Jahre gegenseitiger Sondierungen und Konsultationen quer durch Europa. Auch der schweizerische Aussenminister und seine Chefbeamten machten bei diesem Besuchsreigen mit und intensivierten die Empfänge ausländischer Amtsträger in Bern sowie die eigenen Reisen ins Ausland nach damaligen helvetischen Massstäben schon fast ins Ungeheuerliche. Am regsten war der Austausch mit den anderen Neutralen – die «Auffassungen in Schweden und Österreich stimmen mit den unsrigen weitgehend überein». Aber auch den neuartigen Gedankenaustausch mit den hinter dem «Eisernen Vorhang» gelegenen Ländern Osteuropas empfand die Schweizer Diplomatie als überraschend fruchtbar.
In sechs Monaten zur Konferenzagenda

Schweizer Einfluss auf die Verhandlungen
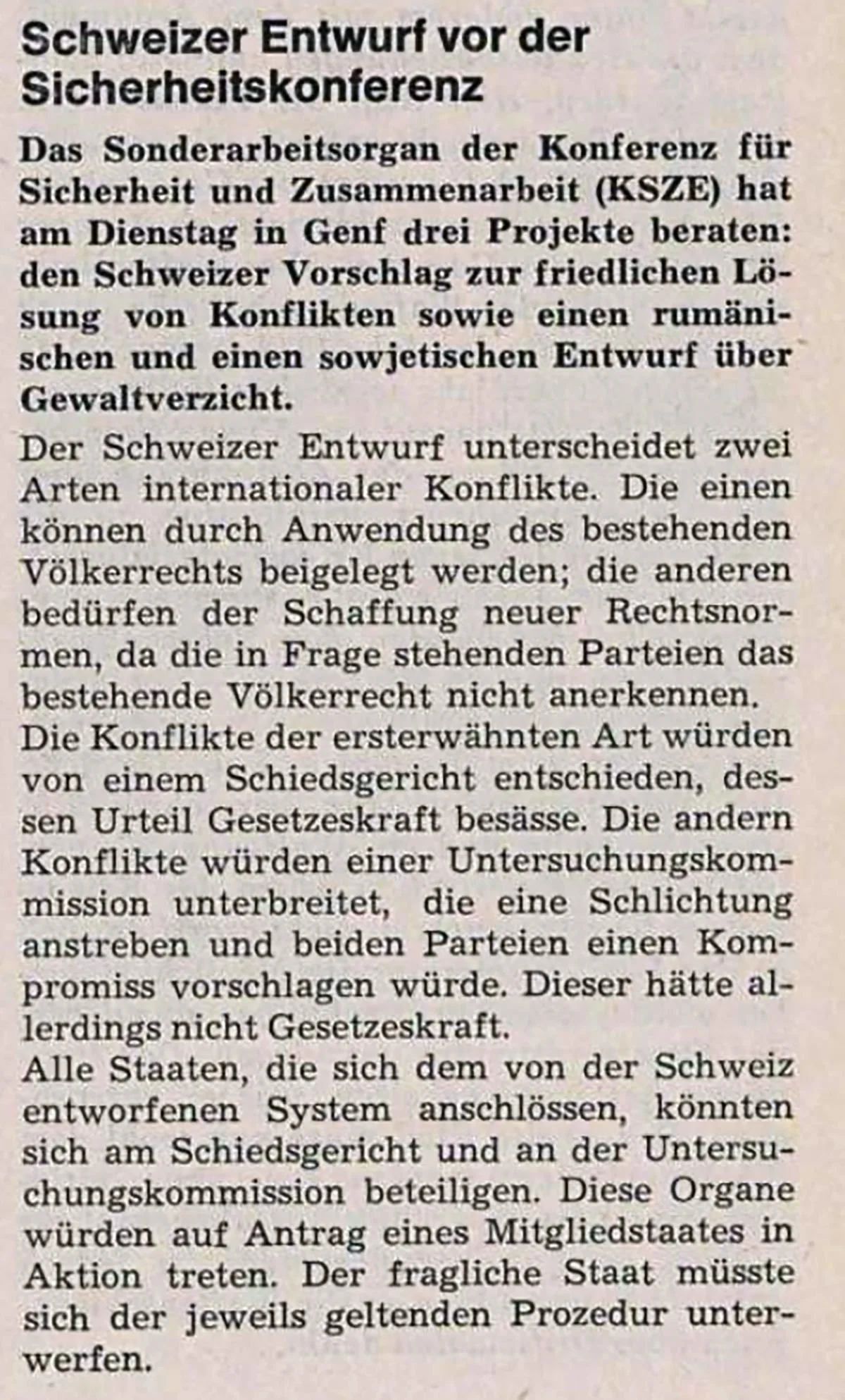
«Tatsächlich handelt es sich hier um die erste Zusammenkunft der Verantwortlichen aller Länder der europäischen Familie», hielt Bundespräsident Graber am 30. Juli in seiner Rede vor den in der Finlandia-Halle versammelten Staats- und Regierungschefs fest. Zwar wirkten die Resultate auf den ersten Blick bescheiden und entsprächen nicht allen zuvor gehegten Hoffnungen, stellte der Magistrat kritisch fest. «Und dennoch! Allein der Umstand, dass derart heikle Fragen in aller Offenheit auf diplomatischer Ebene zwischen Staaten von unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen aufgegriffen und diskutiert werden konnten, ist an sich schon ein positives Element. Und die Tatsache, dass die gleichen Länder sich auf Texte einigen konnten, die zumindest das Verdienst haben, zu existieren, ist ein weiterer Grund zur Hoffnung.»

Die Schweiz, die weder Mitglied der UNO, noch der Europäischen Gemeinschaft war, konnte sich im KSZE-Prozess erstmals als eigenständiger und allseits respektierter Akteur in zentrale Fragen einbringen und eine gesamteuropäische Politik mitgestalten. Die KSZE markiert eine Abkehr vom helvetischen Sonderfalldenken und damit den eigentlichen Beginn einer Normalisierung der schweizerischen Aussenpolitik. In den Jahren 1996 und 2014 übernahm das Land als Vorsitzende der OSZE eine zentrale Rolle – 2026 wird die Schweiz die Organisation erneut präsidieren.
Vielleicht kann die OSZE dereinst wieder ein Instrument einer gesamteuropäischen, auf der Gleichheit aller Staaten beruhenden Sicherheitspolitik werden. Dann wäre der 1. August vor 50 Jahren fürwahr einer der besten seit langem gewesen.
Gemeinsame Forschung

Der vorliegende Text ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Nationalmuseum und der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz. Inspiriert vom 50. Jahrestag der KSZE-Schlussakte von Helsinki und dem schweizerische OSZE-Vorsitz 2026 betreibt Dodis zurzeit Forschungen für zwei Publikationen zur Geschichte der KSZE/OSZE. Die im Text zitierten Dokumente und zahlreiche weitere Akten zum Thema sind online verfügbar.