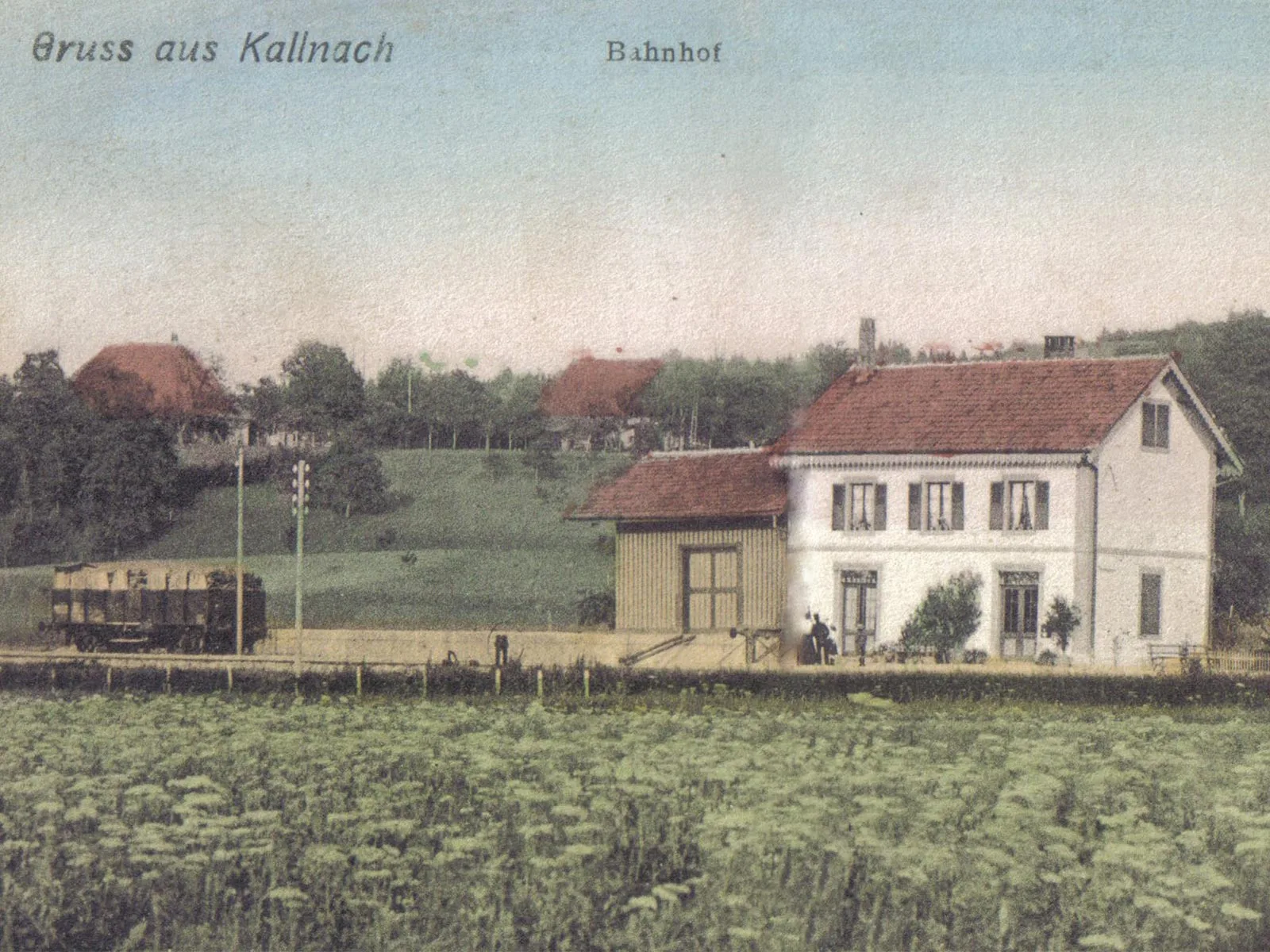Material und Magie – «Zwinglis Helm» auf Zeitreise
Der Eisenhelm in der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums soll einmal das Haupt des sterbenden Ulrich Zwingli (1484-1531) geschützt haben. Belege für die tatsächliche Herkunft dieser katholischen Trophäe gibt es aber nicht.
Zahlen haben eine hohe Glaubwürdigkeit und Geburtstage von Menschen, Ereignissen und Dingen feiern wir. Welchen Geburtstag, welche Zahlen können wir als Fixpunkt in der Überlieferung und dabei für die Echtheit eines Eisenhuts ins Feld führen, der als «Zwinglis Helm» in die Geschichte eingegangen ist?
Das Design des Eisenhuts legt ein Alter von rund 500 Jahren nahe. Eine Materialanalyse könnte es präziser bestimmen. Wissen möchten wir aber vor allem, ob der Helm tatsächlich einmal dem Zürcher Reformator Huldrich Zwingli (1484-1531) gehörte. Dafür fehlen uns aber Belege. Es existieren keine zeitgenössischen Quellen. Die erste überlieferte Quelle, die den Helm Zwingli zuschreibt, datiert 74 Jahre nach seinem Tod. Mit dieser zeitlichen Lücke verlieren alle anderen Hinweise rund um «Zwinglis Helm» an Beweiskraft.
1605 verzeichnet das Luzerner Zeughaus diesen Helm als «Zwinglis Jsenhout». In der Folgezeit wird er als Trophäe der Katholiken lanciert: In der Schlacht bei Kappel 1531 hätten die katholischen Innerschweizer den Helm dem besiegten Zürcher Reformator abgenommen.
1805 bildet ein Kupferstich in einem Zürcher Neujahrsblatt «Zwinglis Waffen» – Schwert, Schweizersäbel, Streitaxt – mit Helm ab. Nun sind auch die Zürcher überzeugt von deren «Echtheit» und reklamieren diese als Hinterlassenschaft ihres Reformators für sich. Tatsächlich nehmen sie die Waffen und den Helm mit dem Sonderbundskrieg in Besitz. 1849 werden «Zwinglis Waffen» in einem militärisch-politischen Festakt der Zürcher Regierung übergeben und in einer Art Prozession ins städtische Zeughaus überführt. 1898 gelangt das Ensemble aus Schwert, Streitaxt und Helm in die Sammlung des neuen Schweizerischen Landesmuseums.
Bei jedem Rite de Passage, den der Eisenhut in seinem öffentlichen Leben durchlaufen hat, wurde er erneut getauft auf den Namen «Zwinglis Helm». Die Präsentation im Zürcher Zeughaus und dann im Landesmuseum erhebt ihn zur Berührungsreliquie. Als vom Reformator persönlich berührtes Ding liegt er unberührbar hinter Glas, während Zuschreibungen ihm Erhabenheit verleihen. Trotz fehlender Gewissheit legen Historiker und Kuratoren immer wieder nahe, dass der Helm vor über 500 Jahren auf dem Haupt des Reformators thronte, mehr noch, er nach Zwinglis gewaltsamen Tod in der Schlacht von seinen Gegnern erbeutet worden sei. Wer weiss, vielleicht ist es sogar so gewesen. Die Geschichte des Helms ist kein direkter Beleg dafür aber auch kein schlagkräftiger dagegen. Der Helm gibt seine Geschichte erst seit dem frühen 17. Jahrhundert Preis.

Hans Asper (1499 - 1571), postum ausgeführtes Tafelgemälde von Ulrich Zwingli, 1549. Öl und Tempera auf Holz. Depositum: Zentralbibliothek Zürich

Die Druckgraphik von Johann Martin Usteri (1763 - 1827) und Johann Rudolf Schellenberg (1740 - 1806) zeigt Zwingli zu Pferd umgeben von Kriegsleuten beim Auszug in die Schlacht bei Kappel 1531. Bild: Schweizerisches Nationalmuseum
Der angebliche Eisenhut von Ulrich Zwingli. Auf der Seite ist Zwinglis Name eingraviert. Die Gravur ist deutlich jünger als der Helm. Woher das Loch stammt, ist gänzlich unbekannt. Es könnte durchaus im Zeughaus gezielt herausgebrochen worden sein, um dem Hut als Kriegsbeute Authentizität zu verleihen. Der Helm ist im Landesmuseum Zürich ausgestellt. Fotos: Schweizerisches Nationalmuseum