
Plastikhenne und Schneewittchensarg
Mehr als dreissig Jahre nach dem Mauerfall zeigt das Vitra Design Museum deutsch-deutsches Design von 1949-89. Durch die zeitliche Distanz werden Trennendes und Gemeinsames besonders gut sichtbar.
Gehrys Bau bildet derzeit die Kulisse für ein etwas weniger glamouröses Designprodukt, das aber auf seine Weise auch eine Signatur trägt. Die Rede ist von einem petrolblauen Trabant-PKW. Anders als für Gehrys Architektur war für das aus heutiger Optik geradezu mitleiderregende Gefährt 1989 Schluss: Der Fall der Mauer, der Zusammenbruch der DDR bedeutete auch das Aus für das bescheidene Vehikel. Dabei war der «Trabi», wie schon der Kosename zeigt, jahrelang das schwer erreichbare Objekt der Begierde vieler DDR-Bürgerinnen und Bürger gewesen. Er stand für ein kleines Stück persönlicher Freiheit in einem Staat, der sie durchs Band gängelte.

Von der «Formgestaltung» zum «Design»
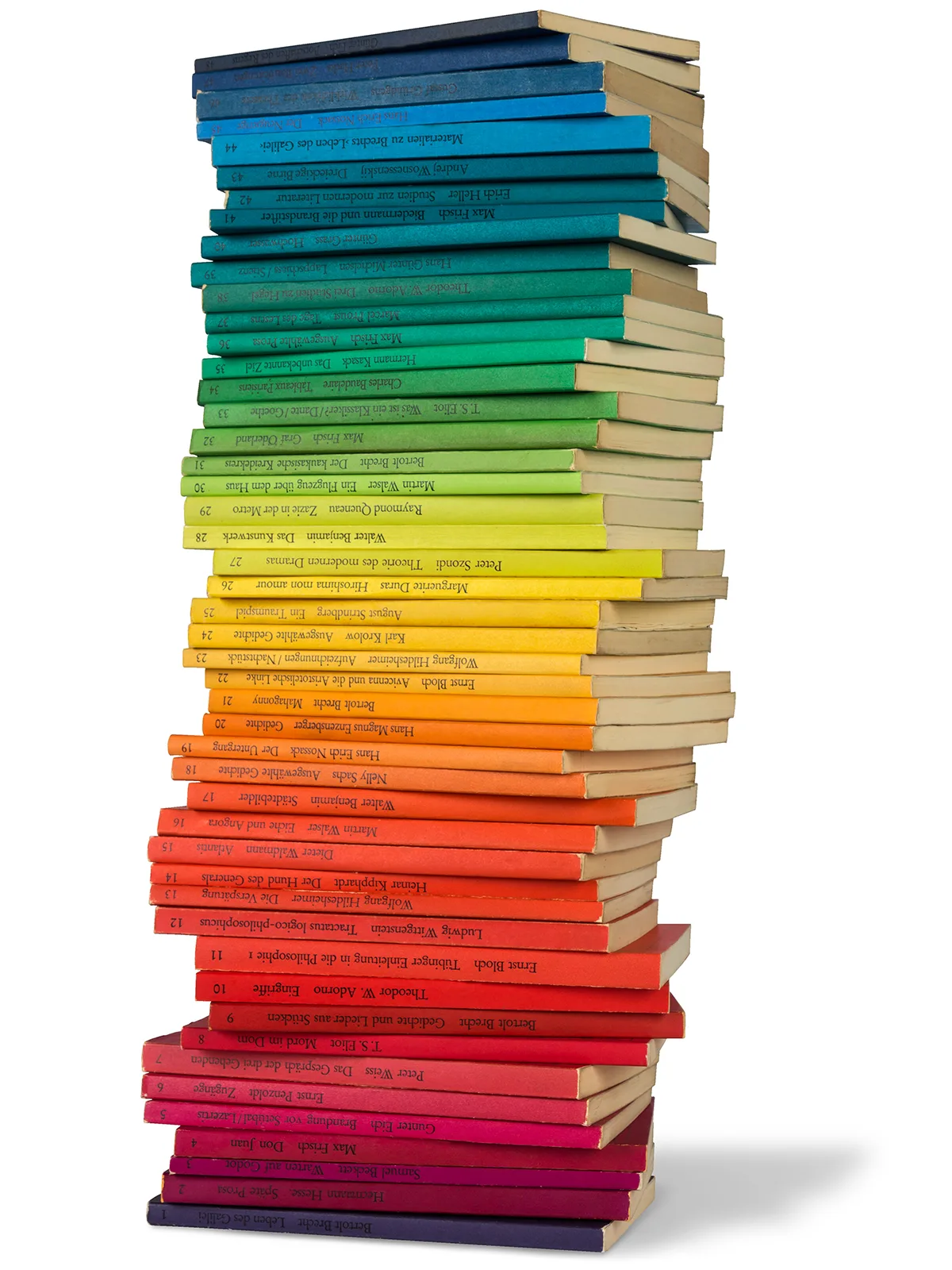
Da und dort spielen die Ausstellungsmacher auch mit «(N)ostalgie»-Effekten, wie etwa bei den bunten DDR-Plastik-Eierbechern in Hühnerform oder den Birkenstock-Ökolatschen aus den 70er-Jahren. Beide sind heute Kult.

Konsum-Paralleluniversen des 20. Jahrhunderts
So lässt der historische Abstand beide Designwelten als Spielarten eines insgesamt modernistisch geprägten Epochenstils erscheinen. Aus dem Blickwinkel der Generation Smartphone mutet der «Schneewittchensarg» dabei ebenso museal an wie der DDR-Trabi. Beide stammen aus einer Welt von gestern, in der «Design» neben dem Imperativ der Zweckmässigkeit auch noch für nationale, um nicht zu sagen nationalistische Ansprüche instrumentalisiert wurde. Heute dagegen setzen Elektronik-, Sport- oder Luxus-Konzerne mit ausgefeilten Marketingmaschinerien in Windeseile globale Trends durch.

Überfluss und Mangel
Hingegen wehte in der sowjetischen Besatzungszone, aus der die Deutsche Demokratische Republik hervorging, ein rauerer Wind: Die Sowjetunion liess sich für die im Krieg erlittenen Verluste mit Reparationen entschädigen. Dies bedeutete, dass noch vorhandene Industriestrukturen, Fabriken und Anlagen demontiert und gen Osten transportiert wurden. Unterstützung hier – Aderlass dort: diese Asymmetrie sollte sich später noch verschärfen. Nur in puncto Rohstoffe hatte die DDR den Vorteil von Öl-Direktlieferungen aus der UdSSR, was der petrochemischen Industrie und insbesondere der Plastikproduktion Auftrieb gab. Bittere Ironie: In der DDR-Industrie, die ansonsten von Mangel und ideologischen Gängeleien geprägt war, gab es durchaus Design auf der Höhe der Zeit. Leider kam es kaum je bei den eigenen Bürgern an. Ein Beispiel ist der raffinierte Plastik-Gartenklappsitz «Senftenberger Ei» in Pop-Ästhetik. Entworfen worden war es für den Export gen Westen, um zu den dringend benötigten Devisen zu kommen.

Design einer nationalen Identität
Während die Bundesrepublik für ihren Personalausweis den preussischen Adler übernahm, musste die DDR sich etwas Neues ausdenken. Ährenkranz, Hammer und Zirkel (letztere symbolisierte die Intellektuellen) im Wappen und auf den Münzen standen für die nach sozialistischer Doktrin staatstragenden Stände. Während die D-Mark aus einer relativ schweren Kupfer-Nickel-Legierung bestand, wurde die Ostmark aus dem viel leichteren Aluminium geprägt. Sie fühlte sich entsprechend «billiger» und weniger vertrauenerweckend an. Sparsamster Materialeinsatz, Ersatzstoffe – dieses Thema sollte die «Formgebung» in der DDR auch weiterhin dominieren, wobei die Not nicht selten erfinderisch machte.




