
Baden unter freiem Himmel
Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren Thermalbadebecken unter freiem Himmel das Markenzeichen der Bäder von Baden im Aargau.

Fürsorge und Politik bei den Römern

Im Mittelalter: Bäder für alle – aber nach Ständen getrennt
St. Verenabad und Freibäder
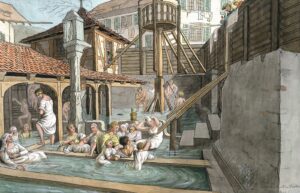
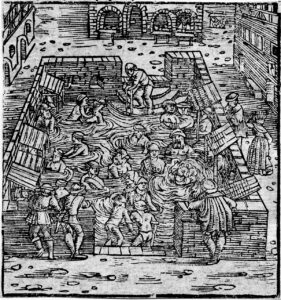
Das Aus für die Bäder unter freiem Himmel

Die Tradition wird wiederbelebt




