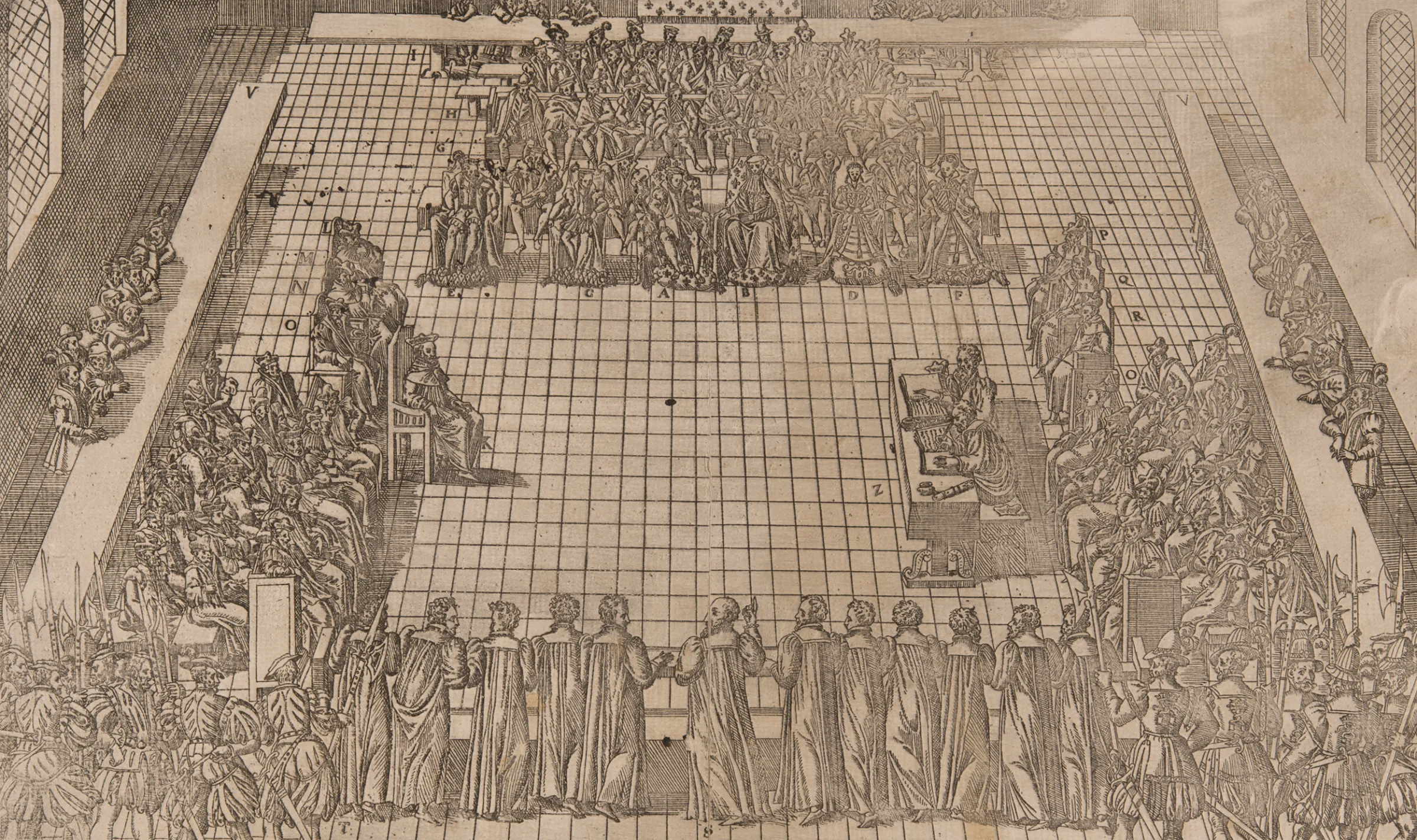
Schweizerisches Nationalmuseum
Die Hugenotten
Als die Protestanten im 17. Jahrhundert in Massen aus Frankreich flüchteten, kamen rund 20'000 Hugenotten in die Eidgenossenschaft. Sie belebten die Wirtschaft und die Kultur ihrer neuen Heimat.
Anne-Marguerite Petit war überglücklich. Endlich war sie den Häschern des Sonnenkönigs Louis XIV. entkommen! Endlich auf protestantischem Boden! Ursache für Anne-Marguerites Flucht von Südfrankreich nach Genf war das Edikt von Fontainebleau. 1685 hatte Louis XIV. die Religionsfreiheit eingeschränkt und die Ausübung des Protestantismus de facto untersagt. Schon zuvor waren Frankreichs Protestanten immer heftiger drangsaliert worden. Man verunglimpfte sie als «Hugenotten», mit dem Wort, das herauskam, wenn französische Zungen «Eidgenossen» zu sagen versuchten. Eine Anspielung darauf, dass die Protestanten von der Schweiz, genauer von Jean Calvin, inspiriert waren.
Die Protestanten flohen in die Niederlande, nach Deutschland, England, Südafrika und in die Schweiz. Die Flucht war gefährlich – besonders für eine allein reisende Frau. Anne-Marguerite schnitt sich deshalb die Haare, verkleidete sich als Knabe und vertraute ihr Schicksal einem Schlepper an. Dieser nahm ihr fast den gesamten Besitz ab, sogar ihr Pferd verkaufte er unterwegs. Besonders brenzlig wurde es, als ein Dorfrichter in Anne-Marguerite einen hugenottischen Jüngling zu erkennen glaubte und erst von ihr abliess, als sie ihm versicherte, sie sei genauso sicher katholisch, wie sie ein Knabe sei. Ob das im Detail stimmt oder einfach gut erzählt ist, bleibt bis heute offen.
Anne-Marguerite wurde später eine Art Klatschreporterin und wusste Texte unterhaltsam zu gestalten. Ihrer Schreibtätigkeit übrigens ist es zu verdanken, dass ihre Geschichte überhaupt aufgeschrieben wurde und damit erhalten blieb. Sicher ist, dass Anne-Marguerite Petit gut aufgenommen wurde, als sie 1686 in der Schweiz ankam. Die protestantischen Eliten sahen in den Flüchtenden Glaubensbrüder, die sie gerne unterstützten. Ausserdem war Mademoiselle Petit früh dran. Im Folgejahr schwoll der Strom deutlich an und am 30. August 1687 erreichten an einem einzigen Tag 8000 Personen Genf – das gerade mal 16'000 Einwohner zählte. Insgesamt durchquerten wohl etwa 60'000 Flüchtende die Schweiz – wobei sie die katholischen Gebiete sorgsam umgingen. Ungefährlich war ihre Reise trotzdem nicht. Am 5. September 1687 kenterten kurz vor Lyss zwei völlig überfüllte Weidlinge. 111 von 137 Passagieren starben.
Die meisten Flüchtenden verliessen die Schweiz in Richtung Norden. Sie fanden ihre neue Heimat vor allem in Norddeutschland, einer Gegend, die infolge des Dreissigjährigen Krieges noch immer entvölkert war. Rund 20'000 Hugenotten blieben in der Schweiz. Anfänglich kam es zu Konflikten mit dem lokalen Gewerbe, langfristig war die Zuwanderung aber wirtschaftlich positiv. Die Hugenotten brachten neue Ideen und Produktionsweisen. Ihr vielzitierter Einfluss auf die Uhrmacherei wird gemäss neueren Forschungen indes gerne überschätzt.

Porträt von Anne-Marguerite Petit.
Wikimedia

Hinterglasgemälde mit Jean Calvin als Sujet. Es entstand um 1820.
Schweizerisches Nationalmuseum



