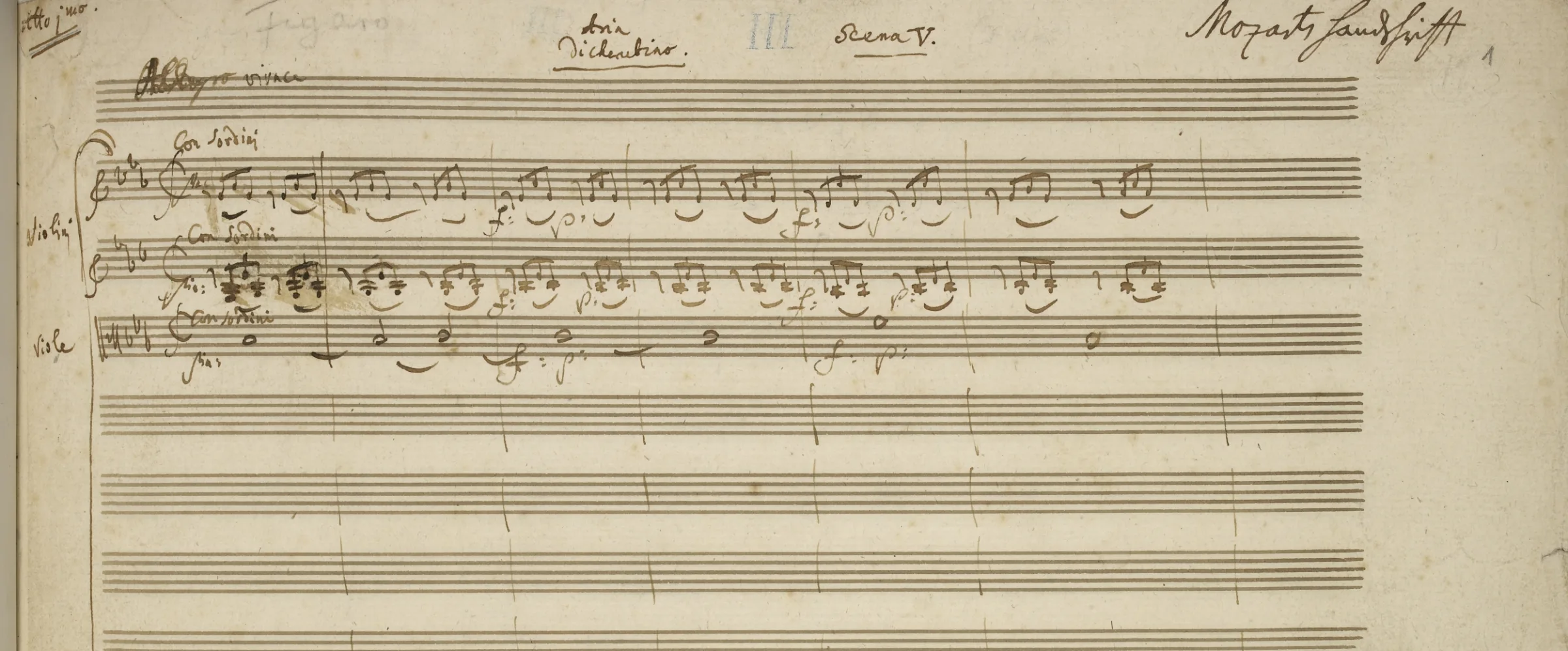Wikimedia, Alte Pinakothek München
Epochaler Wandel – vom Typus zum Individuum
Zuerst waren die Hirten da, dann kamen die Könige. Gemalt wurden sie von Magiern, denn ohne Zauberkünste geht das nicht. Zwei Bilder zum gleichen Thema, unterschiedlich in der Art, ähnlich in der Wirkung: atemberaubend.
Es gibt Dinge, die leicht zu erfahren, aber schwer zu ergründen sind. Dazu gehört der Zauber eines Bildes. Was ist es, das uns beim Anblick schier überwältigt? Sind es die Farben, einmal zart, blass, einmal kraftvoll, leuchtend? Ist es die Bildkomposition, die uns gefangen nimmt? Zieht uns der Ausdruck von Gesichtern in den Bann? Lässt uns der fragende Blick eines Menschen nicht mehr los? Oder ist es die Stimmung eines Bildes, die uns umfängt und entrückt?
Ein rechtes Bild braucht eine rechte Einfassung
Daran liess man es in Zillis nicht fehlen. Auf drei Seiten finden sich gradlinige Muster, auf der vierten Seite wechseln grünliche mit rötlichen Sichelformen auf einem geschwungenen Band. Dazu werden stilisierte rosettenartige Blütenstände je halbkreisförmig eingefasst. Als ob das nicht genug wäre, folgen zwei massive Säulen mit Blattkapitellen, die ein etwas schwerfälliges Gewölbe tragen. Sein dreifacher Abschluss weist gebieterisch nach unten, auf den zentralen Bezugspunkt.

Zillis GR, Martinskirche, Anbetung eines Königs, anonym; eine der 153 originalen quadratischen Bildtafeln, Seitenlänge je rund 90 cm, entstanden kurz nach 1100. Für die Eröffnung des Landesmuseums Zürich 1897 wurden Kopien von 65 ausgewählten Bildtafeln angefertigt. Die Kopien sind seit Herbst 2019 im sanierten Westflügel zu sehen.
LMV Zürich
Das Wichtigste gehört in den Mittelpunkt
Die segnende Hand des Christkinds, übergross, ist das inhaltliche und formale Zentrum des Bildes. Verdoppelt wird dieses Segenszeichen durch den Gestus der linken Hand Marias. Das Kind ruht im Schoss der Mutter, die es mit der Rechten sorgsam sichert und ihm so ermöglicht, ein Füsschen auf ihrem Knie abzustellen. Aus Unbefangenheit wird rasch Ernst: Jesus hält in der einen Hand eine Schriftrolle. Bald schon wird er als Schriftgelehrter wirken. Der Thron der Himmelskönigin könnte einfacher nicht sein. Dennoch verfügt er über eine monumentale Präsenz. Die dazugehörige Bodenplatte verrät erst im Ansatz, dass sich der unbekannte Maler mit der Perspektive befasst.

Die romanische Kirche St. Martin in Zillis GR, erbaut 1109–1114. Ihre berühmte Bilderdecke stammt aus der Bauzeit. Um 1320/40 wurde an der Eingangsfassade ein monumentaler Christophorus angebracht. Der Schutzheilige der Reisenden bewahrte nach altem Glauben am Tag, an dem man sein Abbild betrachtete, vor dem «jähen Tod».
Wikimedia
Ehrerbietung in Vollendung
Heiligkeit hier, Reverenz dort. Der König geht auf den Fussspitzen, Zeichen scheuer Ergriffenheit. Dazu beugt er sich leicht vor. Behutsamkeit und Ehrerbietung werden eins. Damit er die Aura des Kindes nicht tangiere, hüllt der König beide Hände in seinen Umhang. So reicht er demütig seine Schale, nicht wie ein Schenkender, sondern wie ein selbst Beschenkter. Kann eine Darstellung der Begegnung von zwei Königen mehr Hochachtung, Respekt, Würde zum Ausdruck bringen? Das Werk des unbekannten Meisters gehört in den Bilderhimmel.
Typus Gesicht, Typus Dekor – die Kraft der Reduktion
Das Gesicht des Königs lässt keine bestimmte Person erkennen, den Stifter der Bilderdecke etwa. Auch Maria und das Jesuskind haben typisierte Gesichter: Augen, Nase, Mund formen je ein modellhaftes Antlitz. Ist das alles bloss Vorstufe? Haben typisierte Gesichter noch keinen Ausdruck? Wenn wir auf die Augen von Mutter, Kind und König blicken, kommen wir davon gar nicht mehr los.
Die Typisierung setzt sich bei den Objekten fort. Dieselbe einfache Verzierung auf der Königskrone, im Gewölbe und auf dem Fusspodest. Der bläuliche Umhang von Maria ist mit weissen Punkten verziert, gleich wie der Mantel des Königs. Im Mittelalter genügen schematisch-symbolhafte Andeutungen.
Eine Zeitenwende bahnt sich an
Im Obergeschoss der Alten Pinakothek in München wähnt man sich im Saal 1 in einer anderen Welt. 1455 malt Rogier van der Weyden (1399–1464) für die Kirche St. Columba in Köln einen dreiteiligen Altaraufsatz, auf der Mitteltafel die Anbetung des Kindes durch die Heiligen Drei Könige. Thematisch sind «Zillis» und «München» ganz nah beieinander. Alles andere trennt sie meilenweit. Goethe sieht das Bild von Rogier van der Weyden 1814 in Heidelberg, wo es sich damals befindet und ist beeindruckt – von der Strahlkraft der Farben, den akribisch erfassten Einzelheiten, vom tiefen Ernst der Figuren, der sich auf den Betrachter überträgt. Ein Meister begegnet einem Meister.

Rogier van der Weyden, Anbetung der Könige, um 1455. Hier erscheint Körperkontakt nicht nur möglich, sondern selbstverständlich. Die Distanz von Zillis ist aufgegeben.
Wikimedia, Alte Pinakothek München
Was für ein seltsamer Stall! Ruinen eines Steinbaus, dessen Überreste seinen ehemaligen Zweck nicht verraten. Mehrere Rundbogen korrespondieren mit einem zerstörten Segmentgiebel, der an ein tempelartiges Gebäude erinnert. Das schadhafte Dach der erbärmlichen Behausung überspannt notdürftig zwei Räume. Hinten Stall mit Futterkrippe oder Tränke, vorn die «Herberge» der Heiligen Familie. Der Boden eine nackte Steinplatte, roh gebrochen. Ungeziefer kreucht und fleucht. Das alles steht in scharfem Kontrast zur Pracht des Nachbargebäudes, halb Kirche, halb Palast.
Gleichzeitig wird dieser elende Ort zum burgundischen Fürstenhof. Das Vornehmste vom Vornehmen ist grad gut genug. Die reich und kunstvoll verzierten Stoffe sind von einer Pracht, die ihresgleichen sucht. Mit gebotener Demut wird die aktuelle Mode zur Schau getragen: durchbrochene Ärmel mit langem Gehänge. Bei solch wuchtiger Demonstration fürstlich-monarchischer Reputation werden Kronen überflüssig. Die kostbar geschmückten Hüte der drei Könige sind veritabler Ersatz für Königskronen.
Beim Gegensatz von Stall und Fürstenhof hat es kein Bewenden. Auch Leben, Geburt, Tod sind zur selben Zeit am selben Ort vereint. Über dem Christkind hängt bereits der gekreuzigte Christus. Das Kruzifix befindet sich genau im Schnittpunkt von Träger und Balken der Hütte. Das kleine Kreuz wird vom grossen überhöht. Aber nicht nur Leidensweg und Opfertod sind vorgezeichnet, auch die Auferstehung ist angedeutet. Neues Leben blüht aus dem alten Gemäuer.

Siegeszug der Individualität – und Entdeckung der Kindheit?
Ein Dutzend Figuren, allesamt ausgeprägte Charaktere. In der Renaissance und im Humanismus steht das Individuelle für das neue Selbstbewusstsein der Menschen. Das entspricht einem tiefgreifenden Wandel. Überwunden ist alles Typisierende. Das gilt für Maria und Josef, rot gekleidet und mit Hirtenstab, ebenso für die Gruppe von Menschen, die hoffen, bald zum Christkind vorgelassen zu werden – ausnahmslos profilierte Individuen. Das gilt auch für den Stifter des Bildes. Er will erkannt werden. Eigenartig, dass ihn der Maler quasi aussen vor lässt, förmlich ausgrenzt durch eine Mauer mit Bruchsteinen. Dazu ist seine Figur erst noch beidseits leicht angeschnitten. Will der Maler damit anzeigen, dass der Stifter, rein zeitlich, nicht zu dieser Szene gehört?
Warum sollte der Name des Meisters von Zillis der Nachwelt überliefert werden? Er arbeitete doch ausschliesslich zur höheren Ehre Gottes. Ganz anders die Situation bei der Ernennung von Rogier van der Weyden zum Stadtmaler von Brüssel 1436. Für ein solches Amt musste man im wahren Sinn des Worts einen Namen haben.
In Zillis erscheint Jesus noch als kleiner Erwachsener. Das zeigt sowohl der Gesichtsausdruck als auch die segnende Geste. Ein Kind wird gesegnet, segnet noch nicht selber. Bei Rogier van der Weyden dagegen ist Jesus ganz und gar Kleinkind. Nimmt Meister Rogier die «Entdeckung der Kindheit» vorweg, die nach allgemeiner Auffassung erst im 16. Jahrhundert erfolgte?
Von der Vertikalen zur Horizontalen
Auf mittelalterlichen Darstellungen weist ein tonig blauer oder goldfarbener Hintergrund auf das ersehnte Himmelreich. Anders im Zeitalter von Humanismus und Renaissance. Auch die Welt ist es jetzt wert, dargestellt zu werden. Die Entwicklung hat vom Jenseits zum Diesseits geführt, von der Vertikalen zur Horizontalen, zum Erdkreis, auf dem der Mensch wirkt und webt, als aktiv Gestaltender. Das zeigt sich exemplarisch im Bild von Rogier van der Weyden. Im Mittelgrund Wiesen und Auen, ausgeprägte Ländlichkeit, hinten und auf den Seiten städtisches Leben. Die Bauformen sind zeitgemäss gotisch: zuhauf Türme, Treppengiebel und Dachaufsätze, Kreuzstockfenster und gotisches Masswerk. Leicht irritierend, dass das Stadttor einwärts auf eine Landstrasse führt. Aber die Botschaft bleibt klar. Die Senkrechte – Geburt, Kreuz, Himmel – hat künftig einen Gegenpart: die Waagrechte.
Traum einer friedlichen Welt
Über dem Horizont ein lichtes Weiss, das alle Stofflichkeit verloren hat: die Unendlichkeit. Der tiefblaue Himmel deutet in seiner Unergründlichkeit das Jenseits an. Wölklein so sphärisch, wie sie nur im Paradies sein können. Und über allem ein guter Stern, der nicht einmal ganz sichtbar zu sein braucht. Ein paar Strahlen genügen, um der Welt zu bringen, was sie nötig hat: «Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.» Hat Patina angesetzt, sprachlich – aber sonst: würde nach wie vor passen.