
Aussen fix, innen nix
Selten zeigte sich so deutlich wie 1994, dass in der Schweiz Innen- und Aussenpolitik auf das Engste miteinander verzahnt sind. Die Stimmbevölkerung widersetzte sich mehrfach dem internationalen Öffnungskurs des Bundesrats.
Aufgrund der dreifachen Abstimmungsniederlage sah sich der Bundesrat mit einem allgemeinen Vertrauensverlust konfrontiert. Das Land sei gespalten, hielten die Regierungsmitglieder an einer Krisensitzung fest. Gemäss Bundesrat Flavio Cotti, dem Vorsteher des Aussendepartements, sei das politische System in der Schweiz mit einer neuen Art von Opposition konfrontiert, die vom grossen Sieger der EWR-Abstimmung, dem Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Blocher und dessen starken «Erosionskraft» verkörpert werde. «Das Schlimmste wäre es aufzugeben, Blocher Recht zu geben und in unseren aussenpolitischen Bemühungen zu kapitulieren», gab Cotti kämpferisch zu Protokoll.

Der schweizerische Justizminister empfahl deshalb der Staatspolitischen Kommission des Ständerats im November 1994 die Initiative Volk und Ständen gar nicht erst zur Abstimmung zu unterbreiten. Mit einem solchen «vollständigen Bruch mit der humanitären Tradition unseres Landes», so Bundesrat Arnold Koller, «würden wir aufhören, ein Rechtsstaat zu sein, und wären international isoliert.» Es war dies das erste Mal überhaupt, dass der Bundesrat eine Volksinitiative als ungültig erklären wollte, weil sie unvereinbar mit völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz war. Das Parlament folgte dieser Empfehlung im März 1996. Um kritische Stimmen zu besänftigen, stützte Bundesrat Koller seine Argumentation auf die Tatsache, dass die Asylzahlen seit der Einreichung der Initiative gesunken seien und die Regierung neu Zwangsmassnahmen bei der Wegweisung krimineller Asylbewerber und Ausländer vollziehen würde.
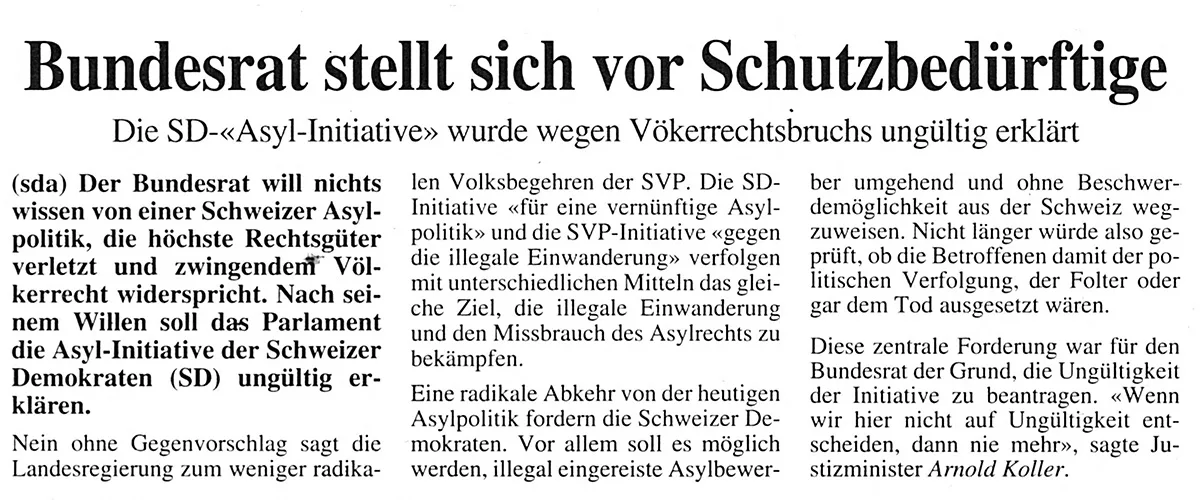
Ob und wie sich Mitglieder des Bundesrats in dieses neue und ungewohnte Format einbringen sollten, diskutierte die Landesregierung in einer Sitzung ausführlich. Verkehrsminister Adolf Ogi hatte seinen missglückten Auftritt in der Sendung über die Alpen-Initiative zu verdauen und Bundesrat Kaspar Villiger – der sich anlässlich der Blauhelm-Vorlage der Arena verweigert hatte – stellte grundsätzlich in Frage, dass Regierungsmitglieder «in Zirkuskämpfe gegen Parlamentarier» antreten sollten. Für Otto Stich, der im Jahr 1994 als Bundespräsident amtete, war die «Teilnahme an kontradiktorischen Sendungen» dagegen kein Problem. Er anerbot sich, am 16. September mit den Gegnern der Vorlage in den Ring zu steigen. Der bünzlig wirkende Sozialdemokrat aus dem Solothurner Schwarzbubenland, der als Finanzminister für einen konsequenten Sparkurs einstand, trug mit seiner unprätentiösen Performance in der Arena vielleicht zur (knappen) Annahme der Antirassismus-Strafnorm bei.
Auf der anderen Seite hatte der mittlerweile omnipräsente Nationalrat Blocher bereits mit dem Referendum gedroht, falls in dem Abkommen zu viele Zugeständnisse gemacht würden. Auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund setzte die Regierung unter Druck, indem er in einem Brief ultimativ flankierende Massnahmen forderte, damit die angestrebte «Liberalisierung nicht zu Lohn- und Sozialdumping» führen würde. Als der Bundesrat im Dezember sein Verhandlungsmandat verabschiedete, musste er also zwischen «zwei Übeln» wählen. Schliesslich entschied er sich aus innenpolitischer Rücksichtnahme dafür, seinen Unterhändlern nur einen begrenzten Verhandlungsspielraum auf ausgewählte Teilbereiche der Personenfreizügigkeit zuzugestehen.

Neu zugängliche Archivdokumente online

Die Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz veröffentlichte am 1. Januar 2025 auf der Internetdatenbank Dodis rund 1700 historische Quellen zur Schweizer Aussenpolitik im Jahr 1994 – pünktlich zum Ablauf der Schutzfrist der relevanten Dossiers aus dem Schweizerischen Bundesarchiv. Die im Text zitierten Dokumente und zahlreiche weitere Akten zu den internationalen Beziehungen der Schweiz sind online verfügbar.



