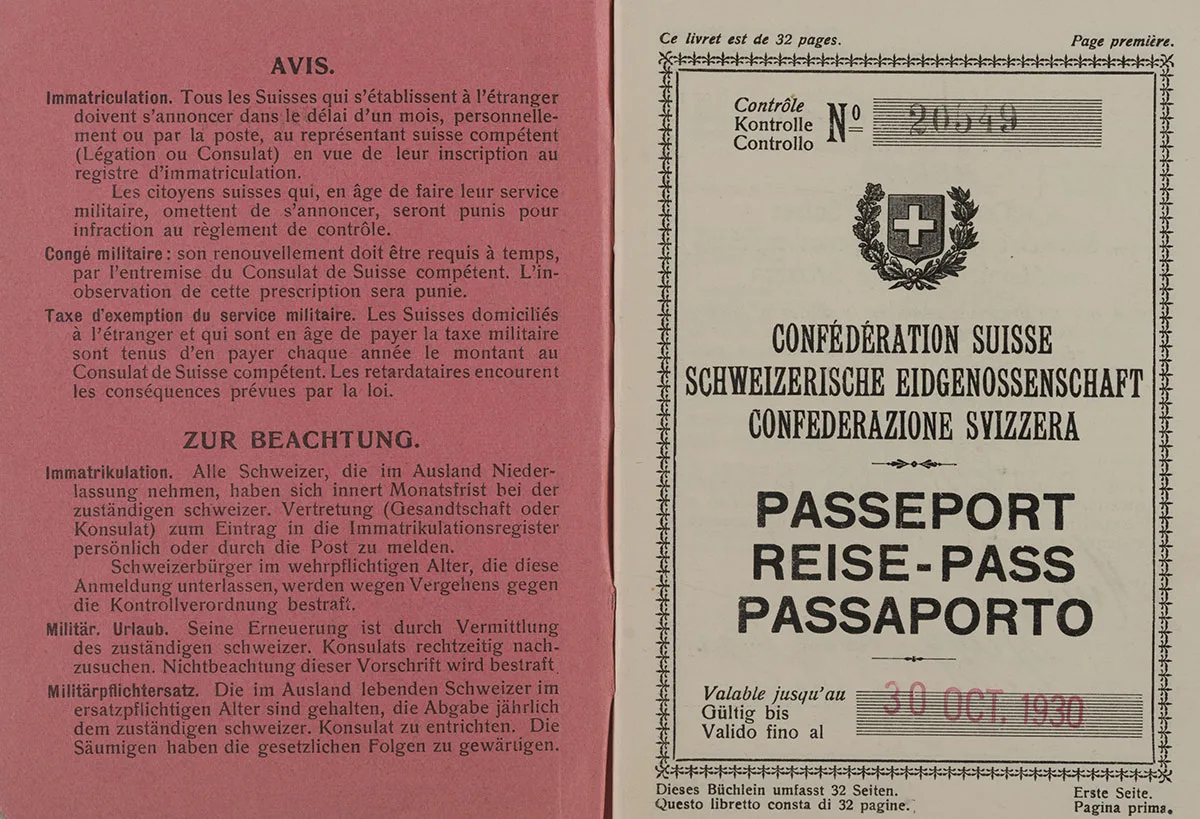Das Genossenschaftsprinzip
Das Genossenschaftsprinzip war für den Aufbau der Schweizer Demokratie unerlässlich. Das UNO-Genossenschaftsjahr 2025 beweist, dass diese Art der Zusammenarbeit auch weltweit eine wichtige Rolle spielt.
Der Schweizer Historiker Adolf Gasser (1903–1985) hat die Bedeutung des genossenschaftlichen Prinzips besonders klar hervorgehoben. Für ihn war die europäische Geschichte stark vom Gegensatz zweier verschiedener Gesinnungen geprägt, und zwar von Herrschaft und Genossenschaft. In diesen Erscheinungen stehen sich, so betont Gasser, zwei Welten gegenüber, die ganz verschiedenen Entwicklungsgesetzen unterstehen: die Welt der von oben her und die Welt der von unten her aufgebauten Staatswesen oder mit anderen Worten die Welt der Gemeindeunfreiheit und die der Gemeindefreiheit.
Die Bedeutung des genossenschaftlichen Prinzips
Meistens gingen die Genossenschaften aus der mittelalterlichen Flurverfassung oder, anders ausgedrückt, aus der «mittelalterlichen Gemeinmark» hervor. Für das Verständnis des schweizerischen Staatswesens sind diese frühen Bezüge des Genossenschaftswesens wichtig. In der Schweiz waren für die allgemeine Verbreitung und Ausgestaltung der Genossenschaften die Allmenden zentral. Dies waren Flächen, die als Weide-, Wald- und Ödlandflächen allen offen stehen mussten.
Die Gründung von Allmenden lief so ab, dass die Bewohner eines Siedlungsverbandes – eines oder mehrerer Dörfer, Weiler oder Hofgruppen – ein bestimmtes Gebiet zur kollektiven wirtschaftlichen Nutzung aussonderten. Dadurch entstand für eine bäuerliche Familie eine Dreiteilung: Neben der Ackerflur und dem Wohnbereich mit Hofstätten und Garten stellte die Allmende eine dritte Zone dar, die gemeinsam verwaltet wurde. Seit dem frühen Mittelalter versuchte der europäische Adel, die Allmendverfassung zu bestimmen oder mindestens zu beeinflussen. An vielen Orten, so auch auf dem Gebiet der heutigen Schweiz, konnte sich das Genossenschaftsprinzip aber halten. Durch die Verschiedenheit der lokalen Verhältnisse entstand mit der Zeit eine Vielfalt von genossenschaftlichen Formen.

Die Bildung der Bürgergemeinden
Die Genossen wurden also zu Dorfbürgern und die bisherigen Dorfgenossenschaften entwickelten sich zu Dorfgemeinden. Dies führte bis 1798 zum Entstehungsprozess der heute noch in vielen Kantonen bestehenden Bürgergemeinden. Die Helvetik bewirkte die Teilung in Einwohner- und Bürgergemeinde. Dadurch intensivierte sich die Aufteilung der Allmende. Einzelne Allmenden gingen in Pacht- oder Privatbesitz über, andere beanspruchten Einwohnergemeinden oder es bildeten sich privatrechtliche Korporationen. Die Korporationen und Bürgergemeinden sind in der Schweiz bis heute ein wichtiges Traditionsgut und stellen menschliche Verbindungen zu Geschichte und Kultur einer Gemeinde her.

Die Genossenschaftsbewegung des 19. Jahrhunderts

Die US-amerikanische Politologin Elinor Ostrom (1933–2012) untersuchte in den 1980er-Jahren in einer weltweit angelegten grundlegenden Studie die «Verfassung der Allmende». Sie erhielt dafür 2009 als erste Frau den Wirtschaftsnobelpreis. Ausgehend von historischen Beispielen aus verschiedenen Kontinenten zeigt sie die Bedeutung des Genossenschaftsprinzips für die Gegenwart auf. Anhand der Allmenden führt sie vor Augen, wie sich Menschen bei knappen, natürlichen Ressourcen organisieren, um gemeinschaftlich komplexe Probleme zu lösen. Ostrom kommt mit ihren umfassenden Studien zum Schluss, dass für eine gute Bewirtschaftung von lokalen Allmendressourcen in vielen Fällen eine Kooperation der unmittelbar Betroffenen besser ist als eine staatliche Kontrolle oder eine Privatisierung. Damit würdigt sie eindrücklich das genossenschaftliche Prinzip.
Zukunft der Genossenschaft
Die drei «Selbst» sorgen im Verbund mit dem Milizsystem für das Einüben einer speziellen demokratischen Kultur. Damit wurde die Genossenschaftsidee historisch betrachtet in vielen Belangen zentraler Bezugspunkt und Fundament für die Entstehung und Entwicklung der direkten Demokratie und der Ausgestaltung des schweizerischen Bundesstaates. Mit der Bezeichnung der «Eidgenossenschaft» besitzt die Schweiz als einziges Land diesen wichtigen historischen Verweis in ihrem Namen.