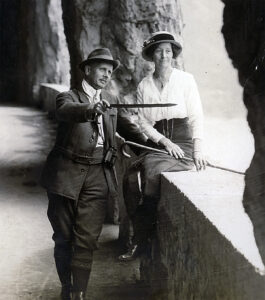Sigg – Inbegriff der Nützlichkeit
Ferdinand Sigg hat mit seinen Aluminiumflaschen die Welt erobert. Doch der Tüftler stellte in Frauenfeld viel mehr her als modische Trinkgefässe.

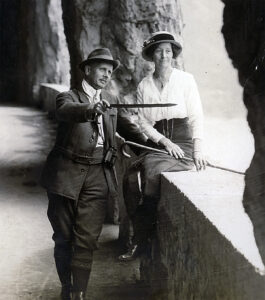




Verdächtiger Leichentransport



Ferdinand Sigg hat mit seinen Aluminiumflaschen die Welt erobert. Doch der Tüftler stellte in Frauenfeld viel mehr her als modische Trinkgefässe.