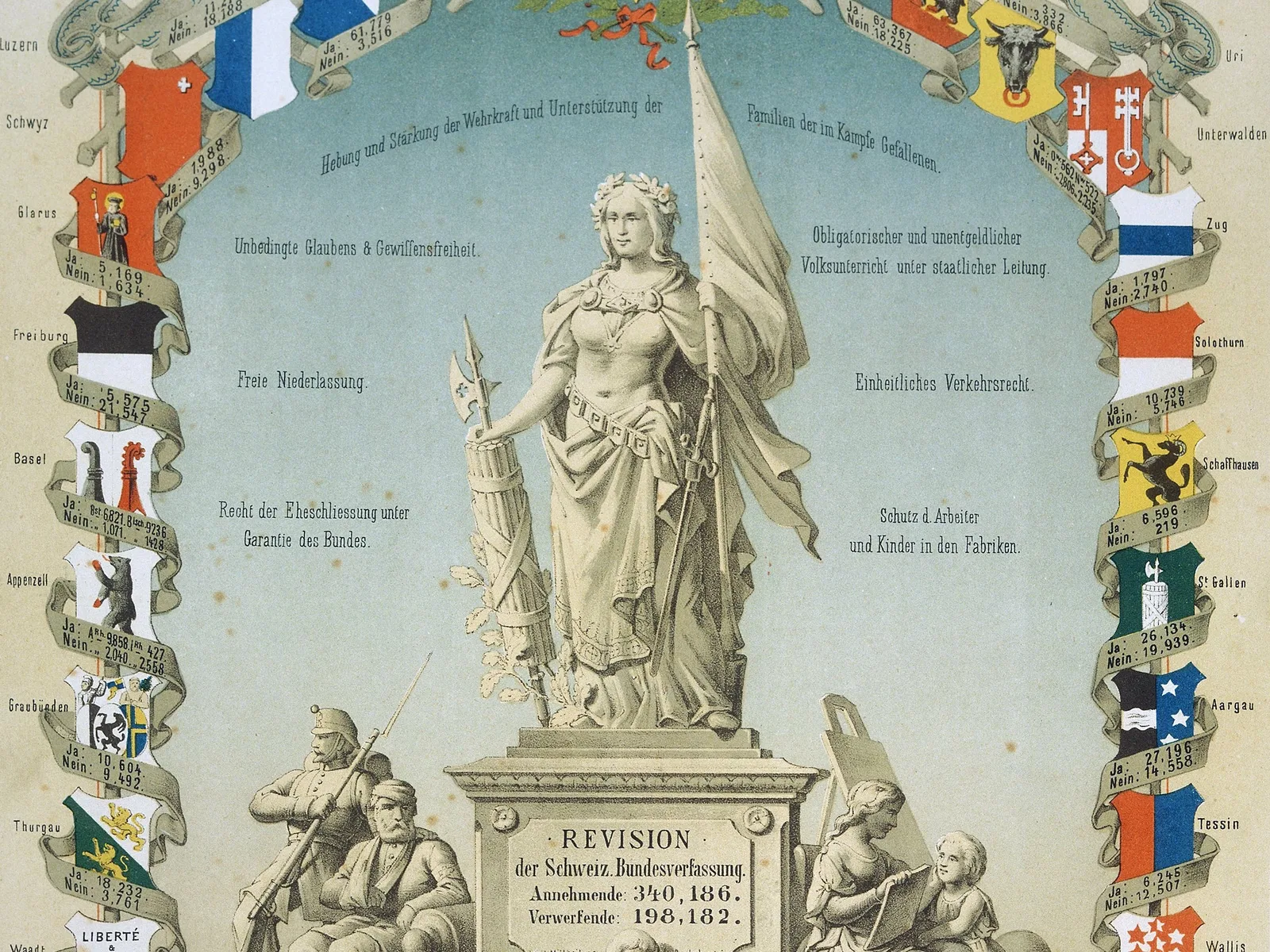Schweizerisches Nationalmuseum
Neustart in Wien
Am Wiener Kongress 1815 wurde Europa neu aufgeteilt. Doch was sollte man mit der Schweiz machen? Schliesslich blieb das Land unabhängig und fungierte als Puffer zwischen den Grossmächten.
Wien im Sommer 1815. In einem Noblen Palais tagt hinter verschlossenen Türen das «Schweizer Komitee». Am Tisch: Zwei Russen, zwei Engländer, ein Preusse und ein Franzose. Die Schweizer Delegation wartet draussen.
Ursache des Wiener Kongresses war Napoleon. Der Korse hatte die Welt aus den Fugen und Europa in blutige Kriege getrieben. Nun war er besiegt und die Sieger sowie Frankreich trafen sich, um zu besprechen, wie der Kontinent künftig aussehen sollte. Es ging um Grenzverläufe, internationales Recht und die Wiederherstellung der alten Ordnung. Sehr viel weiter unten auf der Traktandenliste stand die Frage: Was tun mit der Schweiz? Sie Frankreich zuzuschlagen kam nicht in Frage, sie unter den vier Siegermächten aufteilen, verhiess erneute Konflikte. Ausserdem wollten die Grossmächte einen Puffer zwischen Frankreich und Österreich. Also sollte die Schweiz weiterbestehen – obwohl sie innerlich völlig zerstritten war.
Zerstritten waren auch ihre drei offiziellen Vertreter: De Montenach und Reinhart zankten sich vor dem «Schweizer Komitee». Wieland diskutierte gar nicht erst mit den beiden und las stattdessen lieber Cäsars «Vom Gallischen Krieg». Währenddessen waren in den Vorzimmern die Agenten einzelner Kantone unterwegs. Waadt, Aargau, Thurgau und Tessin lobbyierten für ihre Gleichstellung mit den übrigen Kantonen. Bern dagegen pochte darauf, dass diese wieder zu Untertanengebieten wurden. Genf wiederum wollte sich grosse Teile Savoyens einverleiben, wogegen Zürich Sturm lief, weil die Aufnahme frankophoner Katholiken die Übermacht der deutschsprachigen Protestanten zu Fall gebracht hätte. Und die Walliser träumten ohnehin von einer unabhängigen Republik. Wichtigster Lobbyist war vermutlich Frédéric-César de La Harpe. Er bewog den russischen Zaren dazu, sich für die Unabhängigkeit der Waadt stark zu machen – und für den Fortbestand der Schweiz.
Am Ende wurden die Grenzen neu gezogen. Die Schweiz verlor das Veltlin, Chiavenna, Bormio und Mülhausen, dafür erhielt sie das Gebiet der heutigen Kantone Neuenburg und Jura sowie das Fricktal, Rhäzüns, Tarasp und einige Gemeinden um Genf. Die Kantone wurden einander gleichgestellt, Bern verlor die Waadt und einen Teil des Aargaus, erhielt zum Trost aber den Jura und damit das nächste Problem. Für die Schweiz waren die fremden Richter ein Glücksfall: Sie war innerlich so zerstritten, dass Wieland bemerkte, inländische Richter hätten einen Bürgerkrieg ausgelöst. Nur unter massivem ausländischem Druck konnte die Schweiz als Gefüge gleichwertiger Kantone neu geformt werden.
Mit der Resolution des Wiener Kongresses anerkannten die Grossmächte die Schweiz als unabhängigen Staat. Und verordnete ihr die bewaffnete Neutralität. Diese nahm 1815 allerdings kaum jemand ernst. Sie ging beinahe vergessen und wurde noch während des Kongresses ein erstes Mal verletzt, als Soldaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft – zusammengesetzt aus den Milizen mehrerer Kantone − unter der Führung von General Niklaus Franz von Bachmann im Burgund einmarschierten. Napoleons Rückkehr aus der Verbannung hatte sie mobilisiert. Der Angriff endete allerdings in einem Fiasko. Ihre fast schon mystische Strahlkraft erhielt die Neutralität erst im 20. Jahrhundert durch die beiden Weltkriege.

Porträt von Niklaus Franz von Bachmann in der Uniform eines französischen Generalleutnants. Das Gemälde wurde von Felix Maria Diogg angefertigt.
Schweizerisches Nationalmuseum

Politische Lage nach dem Wiener Kongress im Juni 1815. Karte: Wikimedia / Alexander Altenhof