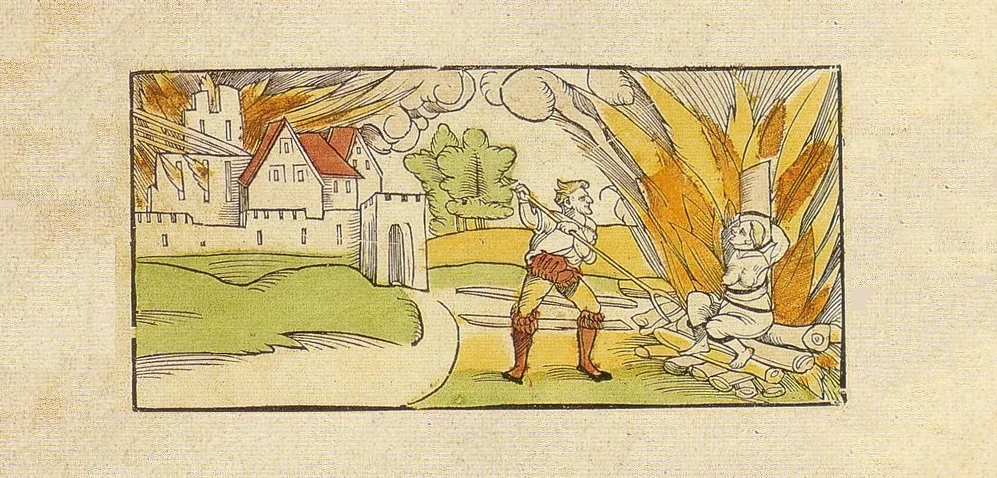Wie die Grosse Pest die Welt veränderte
Die mittelalterliche Pestepidemie und ihre Folgen laden zum Vergleich mit Corona geradezu ein. In seiner packenden Darstellung der «Grossen Pest» warnt der Historiker Volker Reinhardt allerdings auch vor den Grenzen solcher Vergleiche.
Neben der Spanischen Grippe von 1918 bietet sich dafür vor allem die «Grosse Pest» an. Sie hielt in den Jahren 1347 bis 1353 fast ganz Europa in Schach und flammte später immer wieder auf. Schon im Titel seiner Darstellung dieser Epidemie, «Die Macht der Seuche», lässt der Freiburger Historiker Volker Reinhardt seine zentrale Frage anklingen: Wie veränderte sie die damalige Welt? Und gibt es Parallelen zur Corona-Epidemie? Allerdings warnt er dann schon in der Einleitung zu seiner sehr gut lesbaren Darstellung vor überzogenen Erwartungen. Der Vergleich hat seine Tücken.
Ein Quantensprung in der medizinischen Entwicklung

Yersinia pestis ist übrigens um die 20’000 Jahre alt. Wie das Coronavirus dürfte der Erreger seinen Ursprung in (West-) China gehabt haben. Dortige Inschriften belegen die Ausbreitung entlang der sogenannten Seidenstrasse – allerdings im damaligen, wesentlich gemächlicheren Reisetempo. Von der Krim und Konstantinopel (heute Istanbul) aus, wo die Genueser ihre Niederlassungen hatten, ging’s Richtung Sizilien und in andere Hafenstädte und Handelszentren. Die Epidemie verbreitete sich dann über die Handelsrouten und schiffbaren Flüsse allmählich nach Mittel- und Nordeuropa. In der Schweiz waren vor allem Genf und Basel die «Einfallstore».
Tiefgreifende gesellschaftliche Erschütterungen

Die Pest stellte das herrschende gesellschaftliche Gefüge ziemlich auf den Kopf. Dies zunächst, weil ein doch sehr beträchtlicher Teil der Bevölkerung starb. Zwar gehen die Schätzungen weit auseinander, doch ein Viertel der Menschen starben im Minimum – und zwar anders als bei Corona quer durch alle Altersklassen. Ähnlich wie bei Corona traf es vermehrt die Ärmeren, die aufgrund der vorhergehenden Hungersnöte schon geschwächt waren und in beengten Verhältnissen lebten. Sie konnten sich nicht einfach – wie Boccaccios jeunesse dorée aus Florenz in der Rahmenerzählung seines berühmten Pestromans «Decamerone» – auf ihre Landgüter absetzen.
Der Bevölkerungseinbruch hatte ökonomisch und politisch erhebliche Folgen. So führte der Mangel an einfachen Arbeitskräften, insbesondere in der aufblühenden Textilindustrie, aber auch in der Landwirtschaft nach den Pestjahren dazu, dass diese ihre Lohnforderungen und Rechte besser durchsetzen konnten. Dies gipfelte in den Bauernkriegen im frühen 16. Jahrhundert.

Politik und Religion auf dem Prüfstand

Zoom auf Brennpunkte und Krisenherde
Zugleich ordnet er sie neu ein. Er zeigt, dass selbst scheinbar faktentreue Schilderungen häufig schon einem bestimmten erzählerischen Interesse unterliegen. Beispielsweise erinnert er daran, dass namentlich Giovanni Boccaccios bereits erwähnte, drastische Darstellung der Pest in Florenz als Rahmenerzählung des «Decamerone» mit einiger Vorsicht zu geniessen ist.
Zum einen war Boccaccio zur Zeit des Pestausbruchs wohl gar nicht in Florenz. Vor allem aber ähnelt seine Schilderung verblüffend jener des antiken Autor Thukydides in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Die Quintessenz lautet: Bei Boccaccio wie auch in weiteren oft zitierten Berichten aus Florenz wird die Seuche als Folie für moralische Erörterungen über das Wesen des Menschen instrumentalisiert. Ähnliche ideologisch grundierte Vermengungen von Fakten und Fiktionen lassen sich als Begleitphänomen von Corona reichlich beobachten – wenn auch bislang vor allem in den diversen Internetforen. Und: Die wirklich repräsentativen Pestberichte sind alle mit einigem zeitlichen Abstand entstanden.

Grundmuster des Umgangs mit der Epidemie
Zusammenfassend stellt der Historiker fest, die Pest habe letztlich «keine völlig neuen Ideen oder Verhaltensweisen hervorgebracht». Sie hat eher wie ein Katalysator gewirkt, indem sie «mit ihren Erschütterungen lange vorher angelegte Überzeugungen, Grundhaltungen und Entwicklungstendenzen gefestigt und verstärkt hat». Ob dies für Corona auch gilt, können wir nun selber beobachten. Eine Betrachtung aus grösserer Distanz, wie sie Reinhardt für die Pest bietet, bleibt allerdings künftigen Historikern vorbehalten.
Die Macht der Seuche – Wie die Grosse Pest die Welt veränderte – 1347-1353
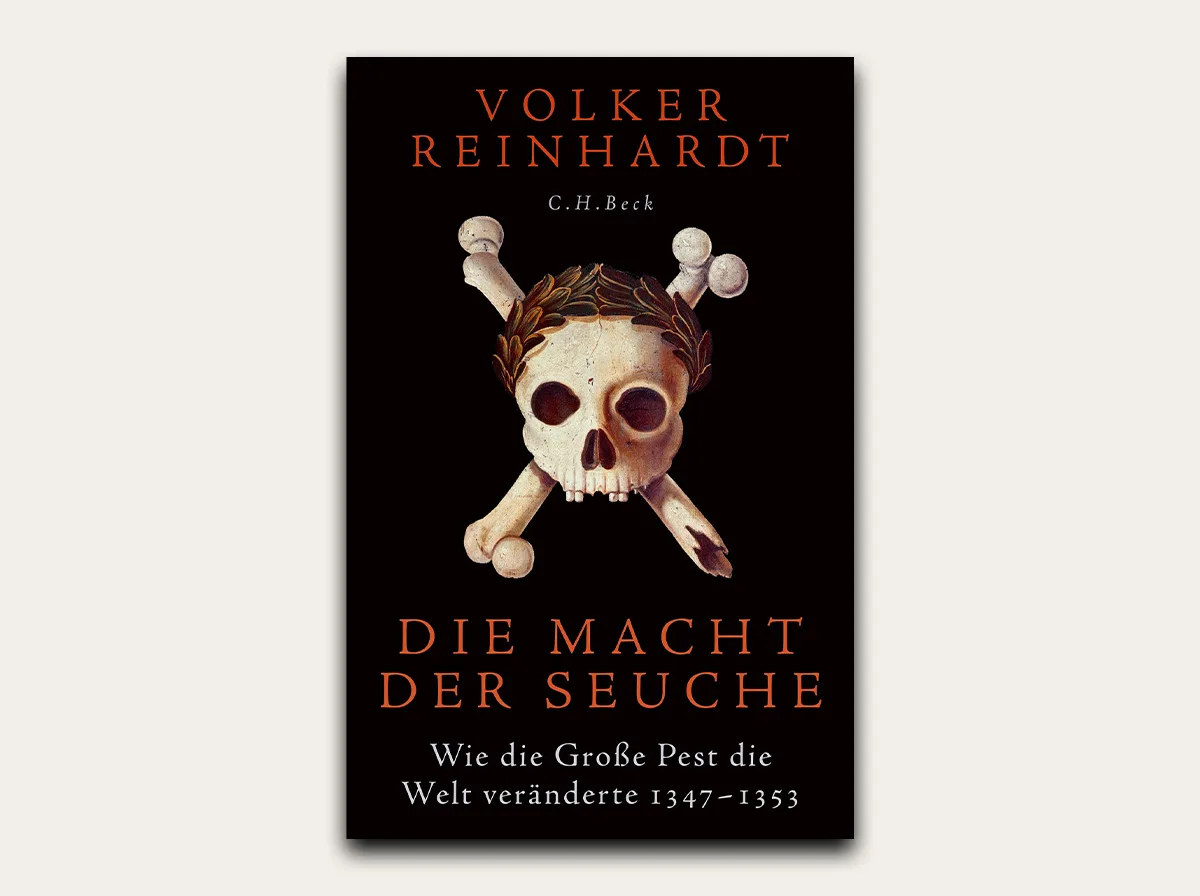
Volker Reinhardt, Verlag C.H. Beck, München 2021.
256 Seiten mit 25 Abbildungen und einer Karte.
256 Seiten mit 25 Abbildungen und einer Karte.