
Griechische Freiheitskämpfer auf Odyssee
1823 verschlug es rund 160 griechische Aufständische in die Schweiz. Sie waren von den Osmanen besiegt und verfolgt worden. Die Flucht erfolgte zu Fuss und führte über Odessa, Bessarabien, Polen und durch deutsche Staaten zur Grenze in Schaffhausen.
Der Geheimbund «Filiki Eteria» plant den Aufstand

Ypsilantis gruppierte rund 500 griechische Freiwillige um sich, die «Hieros Lachos» («Heilige Schar»), mit denen er den gewaltsamen Aufstand vorbereitete. Als Ausgangsort für die Entfesselung der Revolution wählte Ypsilantis das unter osmanischer Vorherrschaft stehende rumänische Donaufürstentum Moldau, das, wie auch die benachbarte Walachei, seit 1812 eine entmilitarisierte Zone war. Der Pruth, ein Nebenfluss der Donau, bildete seither die Grenze zwischen dem Osmanischen und dem Russischen Reich.

Vernichtende Niederlage und Flucht nach Odessa


Während die griechischen Kämpfer in Odessa festsassen und sich laufend neue flüchtige Griechen aus dem Osmanischen Reich dazugesellten, entfesselten sich auf dem Peloponnes und den griechischen Inseln weitere Aufstände. Die meisten Gefechte endeten für die Griechen verheerend – oft auch für die Zivilbevölkerung. Das Massaker an Zivilisten durch die osmanischen Truppen auf der Insel Chios im Frühjahr 1822 beeinflusste die internationale öffentliche Meinung zugunsten der Griechen massgeblich und förderte die Ausbreitung des seit dem späten 18. Jahrhundert in Europa gewachsenen Philhellenismus – eine verklärend-schwärmerische Bewegung von Griechenlandbegeisterten, die nun politische und soziale Dimensionen annahm.
Auf dem Marsch von Odessa in die Schweiz

Kaum eingereist, folgte die Ernüchterung: Alle Nachbarländer ausser die deutschen Staaten hatten ihre Grenzen für die Griechen geschlossen – auch Frankreich. Während diplomatische Verhandlungen mit Frankreich eine Durchreisebewilligung für die Griechen anvisierten, koordinierte der Zentralschweizer Philhellenenverein zusammen mit den regionalen Vereinen, lokalen Komitees und freiwilligen Helfenden die Beherbergung und Versorgung der Männer. Mit Spendenaktionen wurden Geld, Lebensmittel und Kleidung gesammelt. Auch kirchliche Kreise und die den Griechen und ihrem Freiheitskampf mehrheitlich wohlgesinnte Schweizer Presse leisteten ihren Beitrag zur Unterstützung der Flüchtlinge.
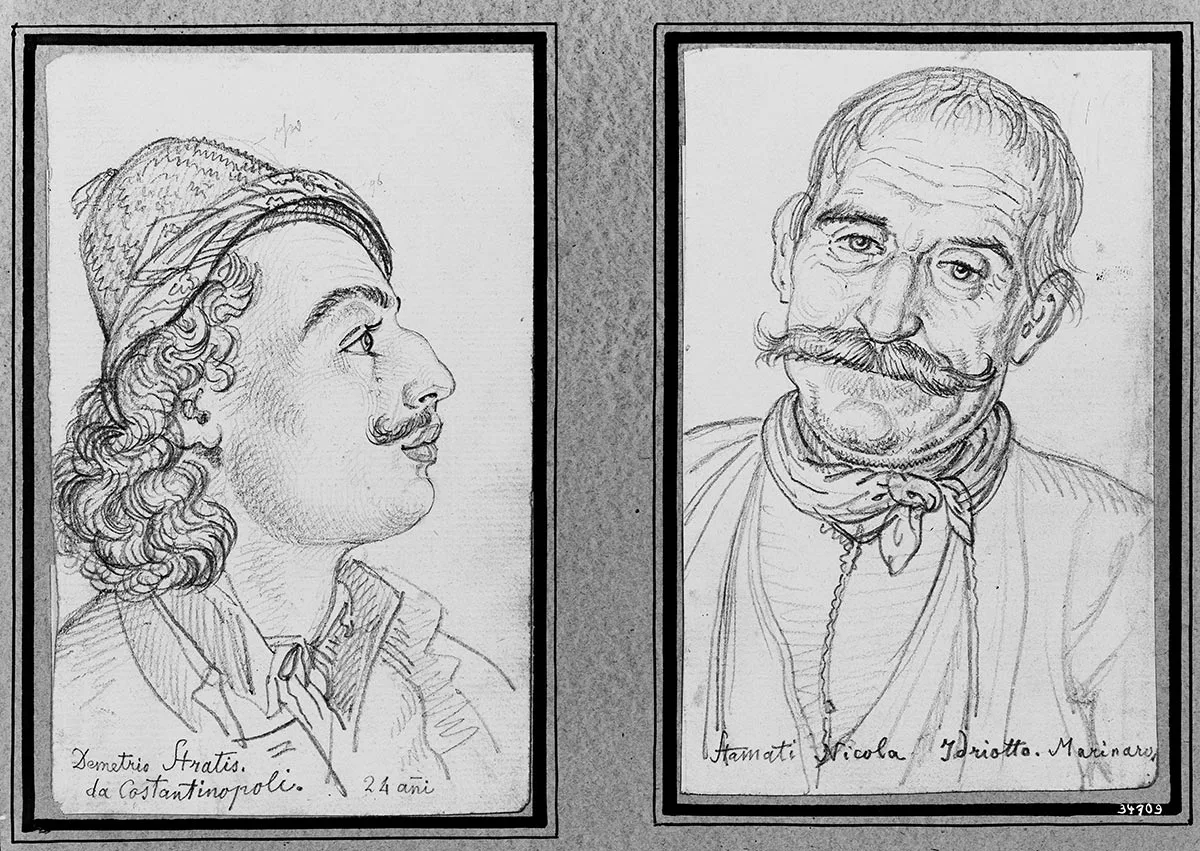
Die Zofinger Philhellenen, allen voran der Arzt und Oberstleutnant Johann Jakob Suter (1757–1831), sowie der Zofinger Frauenverein kümmerten sich um die Aufnahme der Männer, die «von den hiesigen Einwohnern menschenfreundlich und christlich in Wohnung, Speise und Trank verpflegt» wurden. Ihre Unterkunft befand sich im Zentrum der Stadt in einem Gebäude, das der Schützenzunft gehörte.

Überhaupt scheinen die Griechen handwerklich begabt gewesen zu sein. So schnitzten sie zwei kunstvolle Kriegsschiffe aus Holz, die bis heute erhalten geblieben sind. Das grössere Modell ist eine griechische Kriegsschiff-Fregatte mit drei Segeln und 32 Kanonen, die sie «Eleftheria» («Freiheit») tauften. Das kleinere Modell-Segelschiff, ein Zweimaster, nannten sie «Argos». Die beiden Kunstwerke schenkten sie Johann Jakob Suter und der Stadt Zofingen aus Dankbarkeit für deren Gastfreundschaft. Sie gingen später in den Besitz des 1899 gegründeten Museums in Zofingen über, wo sie dauerhaft ausgestellt sind.

Die Reise führte zunächst über Bern nach Genf, wo sämtliche rückkehrwilligen «Schweizer Griechen» – insgesamt sollen es 160 an der Zahl gewesen sein – zusammen den Marsch über Lyon nach Marseille antraten. Von dort aus segelten 158 von ihnen in drei Schiffen in die Heimat. Zwei blieben offenbar freiwillig zurück oder verstarben noch vor der Abreise. Am 5. Juli brachen jedenfalls 39 Mann nach Hydra auf, wo sie am 26. Juli ankamen. 78 Männer stachen am 11. September in See, weitere 41 am 23. November 1823. Die meisten Rückkehrer werden sich nach ihrer Odysee durch halb Mitteleuropa den zahlreichen Kämpfen im Land angeschlossen haben – und viele dabei ums Leben gekommen sein.
Intervention der Grossmächte und Befreiung

Und Ypsilantis? Er erlebte die Befreiung Griechenlands nicht mehr. Ende 1827 aufgrund seiner fortschreitenden Krankheit aus der Gefangenschaft in der Festung Theresienstadt entlassen, starb er im Januar 1828 in der Wiener Pension «Zur goldenen Birne». Er war gerade mal 35 Jahre alt geworden.



