
Eine Hexenjagd im Kalten Krieg
Nach einer Reise in die Sowjetunion im September 1953 geriet die Baselbieter Dichterin Helene Bossert in den Ruf, eine Kommunistin zu sein. Aufgrund der antikommunistischen Stimmung in der Schweiz der 1950er-Jahre sollte dieser Verdacht ihr Leben beinahe zerstören.
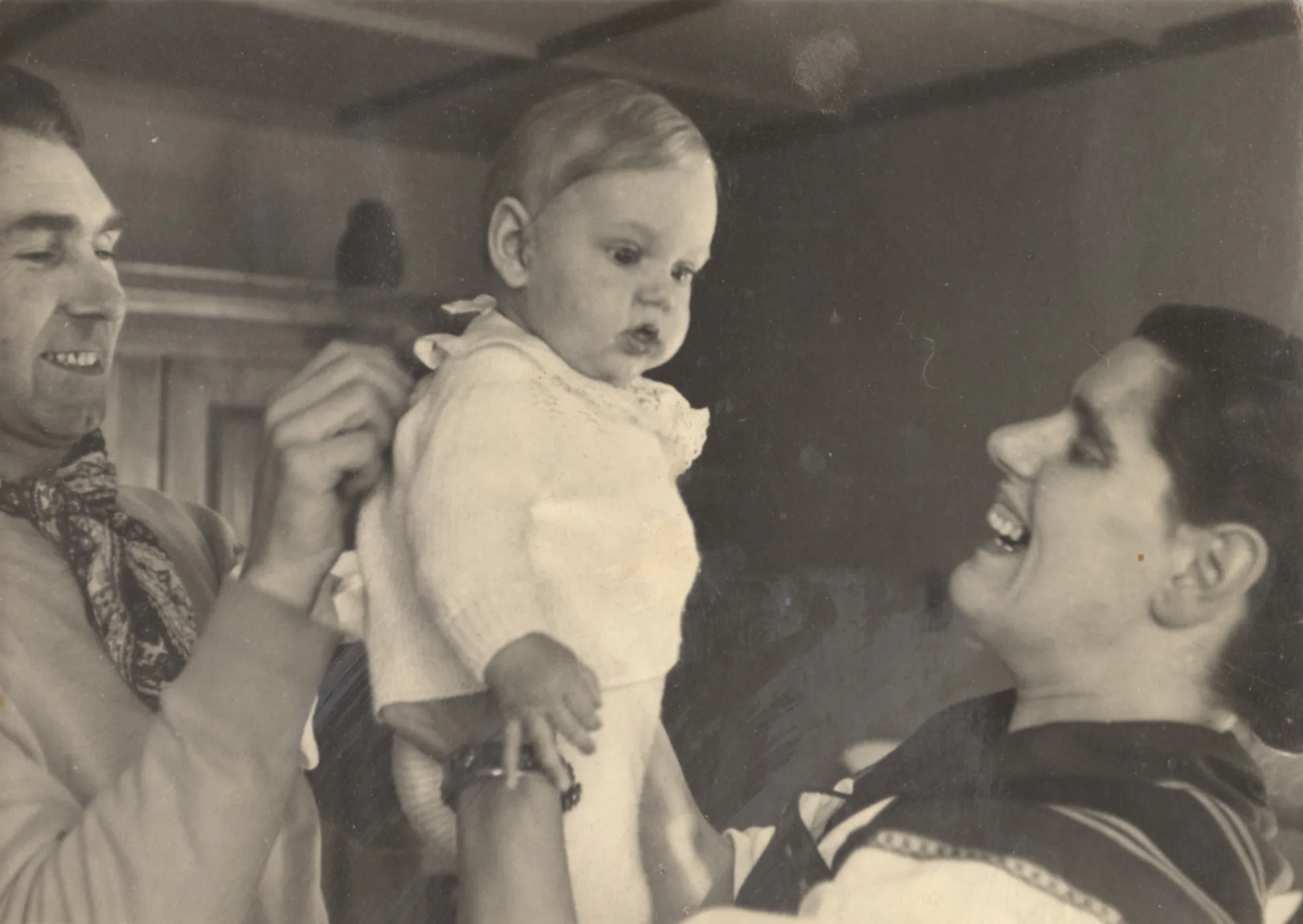
Eine Hexenjagd – politisch, medial und zwischenmenschlich
Dass ihre ganze Familie in Sippenhaft genommen wurde, war eine enorme Belastung für Bossert. Nur ihre symbolische Verbrennung traf sie noch härter: Im Zuge der fasnächtlichen «Chluri»-Verbrennung (vergleichbar mit dem «Böögg» in Zürich) wurde am 11. März 1954 eine ausgestopfte Figur, die Bossert darstellen sollte, zusammen mit ihren Büchern auf dem Sissacher Gemeindeplatz auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Die Parallelen zu den Hexenverbrennungen entgingen Bossert nicht und fanden im Gedicht «Vogelfrei!» kraftvollen Ausdruck:
Vogelfrei!
Z Russland gsi,
Z Russland gsi,
So, die mache mer jetz hi!
Vogelfrei,
Vogelfrei,
Bänglet numme uf se Stei!
Hoppla druuf,
Hoppla druuf,
Bis zu ihrim letschte Schnuuf!
Aber breicht,
Aber breicht,
Settig Häxe sy halt geicht.
Z Russland gsi,
Z Russland gsi,
So, die mache mehr jetz hi!
Eine verhängnisvolle Reise

Helene Bossert überlegte sich ihre Teilnahme lange und kam dann zum Schluss, dass Völkerverständigung nur möglich sei, wenn man sich gegenseitig kennenlerne. Auch muss die Versuchung einer Flugreise ins entfernte Ausland für die weltoffene Dichterin, die bisher kaum über die Grenze ins nahe Deutschland gekommen und noch nie geflogen war, übermächtig gewesen sein.
Propaganda


Für diesen verweigerten Positionsbezug bezahlte sie einen hohen Preis. Jahrelang lebte sie mit ihrer Familie zurückgezogen in einer Art sozialem Feindesland unter grossem Spardruck. Wurde sie zu einer Lesung eingeladen, intervenierte die Bundesanwaltschaft im Hintergrund, sodass die begabte Rezitatorin praktisch keine Möglichkeiten zu öffentlichen Auftritten mehr erhielt.

Kein Einzelfall
Helene Bossert war zwar keine Kommunistin wie Konrad Farner. Doch sie hat mit ihm gemeinsam, dass sie erst im Zuge der 1968er-Bewegung langsam und nur teilweise rehabilitiert wurde.
Sonderausstellung «Helene Bossert – Heimatdichtung und Hexenjagd»
Noch bis zum 17. August 2025 beleuchtet das DISTL – Dichter:innen- und Stadtmuseum die Faktenlage zur spannenden Lebensgeschichte Helene Bosserts.
In der Begleitpublikation setzen sich renommierte Historikerinnen und Historiker vertieft mit Bosserts Nachlass auseinander. Die Publikation ist erhältlich im DISTL, beim Verlag Baselland oder im Buchhandel.
In der Begleitpublikation setzen sich renommierte Historikerinnen und Historiker vertieft mit Bosserts Nachlass auseinander. Die Publikation ist erhältlich im DISTL, beim Verlag Baselland oder im Buchhandel.



