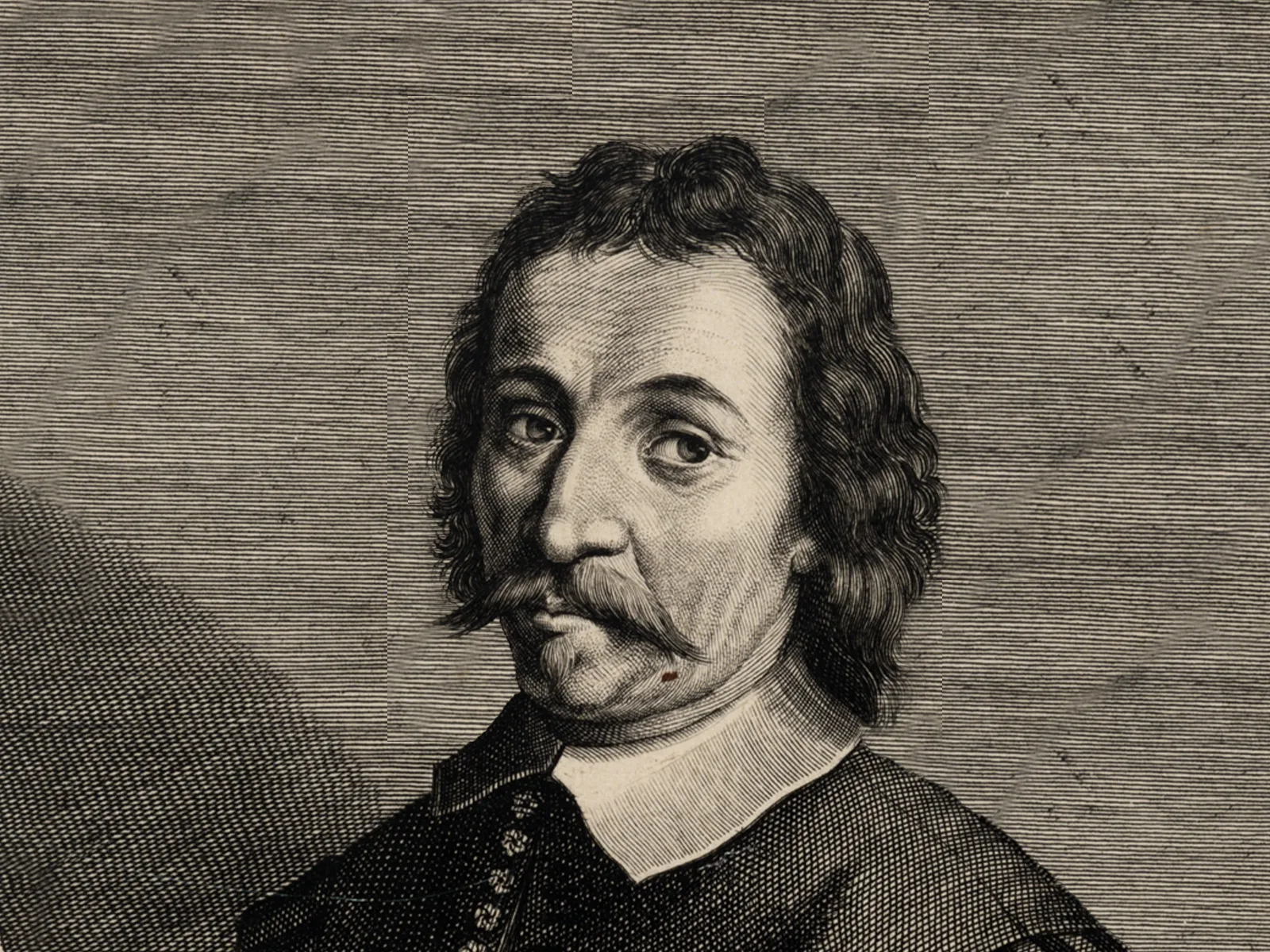Juristisches Zeitalter in der Waadt
Sieben der ersten 36 Bundesräte stammten aus der Waadt. Und alle waren sie Anwälte. Das verwundert nicht, denn die Juristerei hatte im Westen der Schweiz einen hohen Stellenwert.

Die während der savoyischen Zeit noch seltenen Anwälte gewannen während der bernischen Herrschaft leicht an Ansehen. Die Vertreter der Aarestadt organisierten den heterogenen Korpus mit offiziellen Dokumenten und Gewohnheiten, welche dem Alltag der Waadtländerinnen und Waadtländern bis dahin Gestalt gab, ab 1536 fortlaufend. Aber erst mit dem Ende des Ancien Régime und der Errichtung des modernen Staats nach der napoleonischen Zeit gewann der Anwaltsberuf in der Waadt sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf politischer Ebene an Bedeutung.



Juristisches Zeitalter in der Waadt
Das Strafrecht, Grundrechte, die durch die aufeinanderfolgenden Verfassungen sichergestellt wurden, Steuerrecht, Flurrecht, Wirtschaftsrecht, Verwaltungsrecht – alle Aspekte des Rechts wurden während des langen politischen Duells, das sich die Liberalen und Radikalen über Jahrzehnte lieferten, mehrfach überdacht, debattiert, bekräftigt und angefochten. Wenig überraschend waren die Anwälte dabei die grössten Verfechter der neuen Gesetze. Die symbolische Krönung für die Waadtländer Exzellenz im Bereich des Rechts war die Niederlassung des Bundesgerichts in Lausanne gestützt auf die Bundesverfassung von 1874.

Schicksalsjahr 1898

Auguste Dupraz wurde zum ersten Präsidenten ernannt: Präsident und nicht Vorsitzender! Dies war der Wunsch der Gründer gewesen, den sie in Artikel 4 der Statuten der Kammer ausdrückt hatten. Sie zogen die Vereins- zweifellos der Zunftterminologie vor. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nährte die zunehmende Konkurrenz zwischen Anwälten und anderen Rechtspraktikern sowohl auf Waadtländer als auch auf Bundesebene das Gefühl der Verteidigung des Berufs, was zu einer elitäreren Haltung der Kammer führte. Die internen Debatten drehten sich so wiederholt sowohl um die Bezeichnung des Vorsitzenden als auch um die Kleidervorschriften der Anwälte bei den Plädoyers, denn die «Tradition» war im 20. Jahrhundert nicht weniger wichtig als in den Jahrhunderten zuvor.

Im März 1917 setzte sich der frühere Vorsitzende Aloïs de Meuron (1854–1934) sogar im Nationalrat, in dem er seit 1899 einen Sitz hatte, gegen die Deportation französischer und belgischer Zivilpersonen nach Deutschland ein. Er hielt eine flammende Rede, die im Geist an jene von André Malraux von 1964 erinnert, und es verdient hätte, in die Geschichte einzugehen: «Man muss wissen, wann moralische Interessen über materielle Interessen zu stellen sind. Und denjenigen, die Angst davor haben, entgegnen wir, dass man niemals zögern darf, eine moralische Pflicht des höheren Gewissens zu erfüllen, was auch immer die Konsequenzen sein mögen.» Dieser Geist sollte sich auch während des Zweiten Weltkriegs zeigen. Die Judenfrage sorgte in der Kammer für lebhafte Debatten, insbesondere zwischen Marcel Regamey, dem Gründer der Bewegung Renaissance Vaudoise, und dem früheren Vorsitzenden Charles Gorgerat. Die Kammer entschied sich schliesslich für einen passiven Widerstand gegen die Vorurteile, die damals von zahlreichen Personen mitgetragen wurden. Sie achtete aber sorgfältig darauf, sich nicht zu den von der Waadtländer Verwaltung ergriffenen Massnahmen zu äussern.